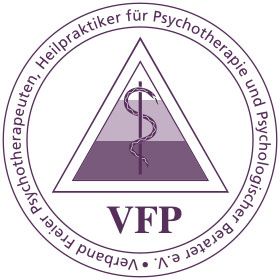Wenn Prestige nur geliehen ist
DIE PSYCHOLOGISCHE DYNAMIK VON STATUSÜBERTRAGUNG UND FAMILIÄRER ENTWERTUNG
In einer Zeit, in der soziale Zugehörigkeit und mediale Sichtbarkeit zunehmend als Währung gesellschaftlicher Anerkennung gelten, ist eine interessante Beobachtung zu machen: Es mehren sich Konstellationen, in denen Menschen versuchen, ihre persönliche Bedeutung aus der bloßen Nähe zu erfolgreichen, prominenten oder finanziell potenten Personen abzuleiten.
Ich bin bedeutend, weil ich diesen Star kenne.
Social Media befeuert den Trend „Basking in reflected glory“.
Ein von jedermann erlebtes Beispiel dafür
ist es, ein Selfie von sich mit einem Promi in sozialen Medien zu veröffentlichen oder wenn jemand wiederholt die Bekanntschaft zu einer als herausragend empfundenen Person betont. Dieses Verhalten ist nicht nur psychologisch bemerkenswert, sondern kann in familiären Systemen zu erheblichen Spannungen und Entwertungsprozessen führen.
STATUS DURCH ASSOZIATION – EINE FRAGWÜRDIGE STRATEGIE DER SELBSTWERTSTÜTZUNG
Die psychologische Grundidee hinter diesem Verhalten ist klar: Der Mensch hat ein tiefes Bedürfnis nach positiver Selbstbewertung. Fehlt es an eigener Leistung, innerer Sicherheit oder echter Anerkennung, kann die Identifikation mit Größeren eine vermeintliche Kompensation darstellen. Man ist also selber „wichtig“, weil man Menschen kennt, die „wichtig“ sind oder subjektiv so beurteilt werden. Dieses Phänomen wird in der Sozialpsychologie „Basking in reflected glory“ (Cialdini et al., 1976) genannt: Menschen versuchen, den Glanz anderer auf sich selbst zu übertragen, indem sie soziale Nähe inszenieren oder betonen.
Solange dies eine harmlose Selbstaufwertung bleibt, ist es sozialverträglich. Problematisch wird es, wenn diese Fremdglorifizierung zur zentralen Selbstwertquelle wird und in einem exklusiven Besitzanspruch mündet: „Ich bin bedeutend, weil nur ich diese Person kenne.“ Damit einher geht oft das Bedürfnis, anderen genau diese oder eine gleichwertige Verbindung zu einer bedeutenden Person abzusprechen – sei es, um sich selbst zu sichern oder um die Einzigartigkeit der eigenen Statusillusion zu bewahren (Tesser, 1988).
FAMILIÄRE ENTWERTUNG ALS NEBENWIRKUNG NARZISSTISCHER KOMPENSATION
In Familien, in denen ein Mitglied seine Identität in starker Weise über solche externen Zugehörigkeiten definiert, entsteht oft ein implizites Hierarchiesystem. Die „wichtige“ Person inszeniert sich als Torwächter zur Bedeutung, während andere – insbesondere solche, die diese Strategie nicht teilen oder kritisieren – als banal, unambitioniert oder nicht zugehörig abgewertet werden (Kernberg, 2006).
Diese familiäre Entwertung kann verschiedene Gesichter haben: - systematische Geringschätzung von Leistungen oder Interessen anderer - ironische oder überhebliche Kommentare („Du hast doch mit so was gar nichts zu tun“ oder „Du kennst solche Leute gar nicht“)
- subtile Statusinszenierungen (z. B. Erwähnungen von Prominenten oder herausragenden Bekannten bei jeder Gelegenheit)
- Ausgrenzung oder Abwertung bei Diskussionen über Themen, zu denen angeblich nur die „wichtige“ Person Zugang hat. Solche Verhaltensweisen können bei anderen Familienmitgliedern tiefe Verunsicherung, chronische Kränkungen, sogar soziale Rückzugsreaktionen auslösen. Besonders belastend ist die Situation für Kinder oder Geschwister, die in einem solchen Klima lernen, dass Zugehörigkeit und Anerkennung nicht durch Authentizität, sondern durch Glanz von außen erworben werden muss (Schmidbauer, 2015).
ABWEHR UND GEGENMECHANISMEN IN BETROFFENEN SYSTEMEN
Familienmitglieder entwickeln oft Strategien, um sich gegen die permanente Statusdegradierung seitens einer solchen „wichtigen“ Person zu schützen:
Ironisierung: Die „wichtige“ Person wird insgeheim belächelt oder karikiert.
Vermeidung: Themen, in denen der Status zur Sprache kommen könnte, werden gemieden.
Gegennarzissmus: Andere Familienmitglieder inszenieren nun selbst Zugehörigkeit zu „wichtigen“ Kreisen.
Emotionaler Rückzug: Die Beziehung zur statusfokussierten Person wird distanziert oder abgebrochen.

In der therapeutischen Praxis ist es von Bedeutung, diese Dynamiken nicht nur als interpersonelle Konflikte zu lesen, sondern auch als Ausdruck tiefen Bedürfnisses nach Anerkennung, Sicherheit und Dazugehörigkeit. Oft hilft es, den Betroffenen den Unterschied zwischen geliehenem Status und authentischem Selbstwert aufzuzeigen (Kohut, 1977).
THERAPEUTISCHE UNTERSTÜTZUNG DER FAMILIENMITGLIEDER
Da die „wichtige“ Person in diesen Konstellationen meist nicht selbst therapiesuchend ist und ihr Verhalten selten als problematisch erlebt, liegt der therapeutische Fokus auf den betroffenen Familienmitgliedern. Ziel der Intervention ist es, deren Selbstwert, Autonomie und psychische Widerstandskraft zu stärken. Hilfreiche therapeutische Ansätze sind:
Psychoedukation: Die Klienten lernen, narzisstische Dynamiken und die psychologische Funktion von Statussymbolen zu verstehen.
Selbstwertarbeit: Fokussierung auf eigene Werte, Kompetenzen und Lebensziele, losgelöst vom Bewertungssystem der „wichtigen“ Person.
Systemische Ressourcenarbeit: Stärkung alternativer Bindungen, die Anerkennung und Zugehörigkeit bieten.
Abgrenzungstechniken: Vermittlung kommunikativer und emotionaler Strategien, um sich vom abwertenden Verhalten zu distanzieren.
Bearbeitung internalisierter Botschaften: Auflösung unbewusster Überzeugungen, etwa „Ich bin nur wertvoll, wenn ich dazugehöre“.
Die therapeutische Arbeit betont die Wiedergewinnung innerer Autonomie. Indem Betroffene sich von fremden Prestigezuschreibungen lösen und eine eigene Bedeutung entwickeln, können sie sich dem familiären Entwertungsdruck entziehen.
FAZIT
Die Illusion, durch bloße Nähe zu bedeutenden Personen selbst „wichtig“ zu sein, ist psychologisch verständlich, aber sozial instabil. Im familiären Kontext kann sie zu toxischen Entwertungsmechanismen führen, die das System langfristig belasten. Therapeutisch gefragt ist eine Arbeit an innerem Selbstwert, Grenzen, Kommunikation und der Bewusstwerdung verdeckter Loyalitäten und Abwehrmechanismen. Nur so kann familiäre Authentizität wieder Raum gewinnen gegenüber einem inszenierten Glanz von außen.
Ich bin nur wertvoll, wenn ich voll dazu- gehöre.
Literatur
Cialdini et al. (1976): Basking in reflected glory – Three (football) field studies. Journal of Personality and Social Psychology, 34(3), 366–375.
Tesser (1988): Toward a self-evaluation maintenance model of social behavior. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 21, 181–227). Academic Press.
Kernberg (2006): Aggression in Personality Disorders and Perversions. Yale University Press.
Kohut (1977): The Restoration of the Self. University of Chicago Press.
Schmidbauer (2015): Die hilflosen Helfer – Über die seelische Problematik der helfenden Berufe. Rowohlt.

Christof Steinhauser
Betriebswirt mit psychologischer Zusatzqualifikation, 25 Jahre Erfahrung als CFO führender Unternehmen und im Personal Coaching