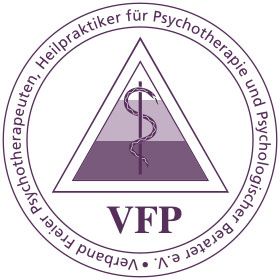Phobische Störung bei Kindern
Wie können wir Kindern mit spezifischen Phobien eine bessere Zukunft bieten? Diese Frage steht im Mittelpunkt einer der dringlichsten Herausforderungen der Kinder- und Jugendpsychologie.
Die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist ein gesellschaftlich wie gesundheitspolitisch hoch relevantes Thema, wobei Angststörungen und spezifische Phobien zu den am häufigsten diagnostizierten psychischen Erkrankungen in dieser Altersgruppe zählen. Trotz ihrer weiten Verbreitung und der erheblichen Beeinträchtigungen, die sie im Alltag der betroffenen Kinder und ihrer Familien verursachen können, werden sie häufig nicht erkannt oder nicht adäquat behandelt. Dies führt zu langfristigen Folgen, wie einem erhöhten Risiko für die Entwicklung weiterer psychischer Störungen und einer nachhaltigen Beeinträchtigung der Lebensqualität der Betroffenen.
Im Fokus dieses Artikels stehen spezifische Phobien, bei denen Kinder unverhältnismäßig starke Ängste vor bestimmten Objekten oder Situationen entwickeln. Diese können von alltäglichen Dingen wie Tieren oder Dunkelheit bis hin zu spezifischen Kontexten wie dem Aufenthalt in geschlossenen Räumen reichen. Die Entstehung der Phobien ist komplex und basiert auf einem Zusammenspiel genetischer, umweltbedingter und lernbezogener Faktoren. GRUNDLAGEN UND ERSCHEINUNGS-FORMEN KINDLICHER PHOBIEN
Die Klassifikation spezifischer Phobien hilft, diese klar von anderen Angststörungen abzugrenzen, was für die Diagnostik und die Wahl geeigneter Interventionen essenziell ist. In der ICD-10 werden spezifische Phobien unter der Kategorie F40.2 geführt, während die ICD-11 die diagnostischen Kriterien durch zusätzliche Aspekte wie kulturelle Kontexte und die Intensität der Beeinträchtigung präzisiert hat. Die stärkere Gewichtung der Alltagsbeeinträchtigung und sozialen Funktionalität in der ICD-11 unterstreicht die Bedeutung, nicht nur die Symptome zu betrachten, sondern auch deren Auswirkungen auf das tägliche Leben.
Typische Beispiele für spezifische Phobien sind Tierphobien, etwa die Angst vor Hunden, und Situationsphobien wie Höhenangst. Diese manifestieren sich laut ICD durch exzessives Vermeidungsverhalten, die das Leben der Betroffenen stark einschränken können. Neben der Differenzierung der Symptome betont die Klassifikation zudem die Bedeutung einer standardisierten Diagnostik, um Überschneidungen mit anderen Angststörungen zu minimieren und altersgemäße Anpassungen zu berücksichtigen. Diese Standards sind besonders relevant, da sich die Symptomatik im Kindesalter häufig von der im Erwachsenenalter unterscheidet.
Die frühzeitige und gezielte Behandlung spezifischer Phobien wird durch ihre meist chronische Verlaufsform besonders bedeutsam. Studien zeigen, dass unbehandelte Phobien häufig zu bedeutsamen Folgeproblemen durch soziale Isolation, schulischem Misserfolg und weiteren psychischen Erkrankungen führen können. Genetische und umweltbedingte Faktoren wirken multifaktoriell bei der Entstehung spezifischer Phobien zusammen. Umweltfaktoren wie stellvertretendes Lernen spielen ebenfalls eine große Rolle: Kinder übernehmen häufig unbewusst emotionale Reaktionen von Bezugspersonen, was die Bedeutung präventiver Elternarbeit betont. Auch instruktionale Einflüsse, etwa übertriebene Warnungen oder Darstellungen von Gefahren, fördern die Entstehung von Ängsten. Traumatische Erlebnisse, wie ein Hundebiss, können in Einzelfällen zu intensiven Angstreaktionen führen, was die Bedeutung von Traumatherapien unterstreicht.
Die häufige Komorbidität von Phobien mit anderen psychischen Störungen, wie Depressionen oder AD(H)S, erschwert den Verlauf der Phobie und stellt eine erhebliche Belastung für die Betroffenen und deren Familien dar. Dieses verdeutlicht die Dringlichkeit integrativer therapeutischer Ansätze, die neben der Phobie auch komorbide Störungen adressieren. Ohne gezielte Therapie zeigt sich oft eine negative Spirale, da Vermeidungsverhalten durch negative Verstärkung die Phobie intensiviert, was alltägliche Aktivitäten wie Schulbesuche oder soziale Interaktionen weiter einschränkt. Körperliche Symptome wie Herzklopfen, Zittern oder Schweißausbrüche begleiten oft die emotionale Belastung der Betroffenen und erschweren deren soziale Entwicklung. Jüngere Kinder drücken ihre Angst oft durch Weinen oder Festhalten aus, während ältere Kinder die Angst rational zu erklären versuchen, was die Diagnostik zusätzlich beeinflusst.
Die Bedeutung spezifischer Phobien im Kindesalter darf nicht unterschätzt werden, da sie unbehandelt schwerwiegende Folgen für die soziale und emotionale Entwicklung haben können.
THERAPIEANSÄTZE UND DEREN WIRKSAMKEIT
Die Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) gilt als besonders effektive Methode zur Behandlung spezifischer Phobien bei Kindern, was durch eine Vielzahl von Studien belegt ist. Eine randomisierte Kontrollstudie zeigt, dass nach einer KVT-Behandlung 64% der Kinder keine diagnostischen Kriterien für eine Angststörung mehr erfüllten, verglichen mit nur 5% in der unbehandelten Vergleichsgruppe.
Ein zentraler Bestandteil der KVT ist das Expositionsverfahren. Die schrittweise Exposition mit angstauslösenden Reizen in einem kontrollierten, sicheren Umfeld zielt darauf ab, eine Gewöhnung an die angstauslösenden Stimuli zu fördern und die Angstreaktion zu reduzieren. Diese Technik hat sich in der Praxis als effektiv erwiesen, doch wird diskutiert, ob sie bei besonders jungen Kindern mit begrenzter kognitiver Reife ebenso wirksam ist. Zudem besteht die Herausforderung, das Expositionsverfahren an die individuellen Bedürfnisse und Ängste des Kindes anzupassen, um Überforderung und damit mögliche Rückschläge zu vermeiden.
Neben der Exposition ist die kognitive Umstrukturierung ein wesentlicher Bestandteil der KVT, der auf die Identifikation und Modifikation dysfunktionaler Denkmuster abzielt. Ziel ist es, unrealistische Ängste durch realistischere Einschätzungen zu ersetzen.
Dieser Ansatz erfordert eine gewisse kognitive Reife und Einsichtsfähigkeit seitens der Kinder, weshalb vor allem bei jüngeren Patienten spielerische und indirekte Methoden zur Anwendung kommen müssen. Die Anpassung der Behandlungsmethoden an das Entwicklungsniveau der Kinder ist entscheidend für den Erfolg der Therapie. Jüngere Kinder profitieren von spielerischen Elementen, während ältere Kinder stärker auf analytische und kognitive Techniken ansprechen. Dieses erfordert von Therapeuten eine hohe Flexibilität und Fachkompetenz.
Die Traumafokussierte Kognitive Verhaltenstherapie (TF-KVT) ist besonders geeignet für Kinder, deren Phobien durch traumatische Ereignisse ausgelöst wurden, da sie spezifische traumabasierte Mechanismen adressiert. Sie integriert klassische KVT-Elemente mit spezifischen Techniken wie der Erstellung eines Traumanarrativs, um emotionale Prozesse zu mobilisieren und die Verarbeitung traumatischer Erfahrungen zu fördern.
Ein Vorteil der TF-KVT liegt in der Einbindung der Eltern, die ihre Erziehungspraktiken optimieren und somit ein unterstützendes therapeutisches Umfeld schaffen können. Diese Intervention stärkt nicht nur die kindliche Resilienz, sondern mindert auch elterliche Belastungen.
Kindliche Phobien können schwerwiegende Folgen für die soziale sowie die emotionale Entwicklung haben.

Systemische Ansätze, die die gesamte Familienstruktur einbeziehen, bieten zudem vielversprechende Möglichkeiten. Sie betrachten familiäre Dynamiken und Stressoren, die die Phobie verstärken könnten, und helfen, diese frühzeitig zu identifizieren und zu mindern. Systemische Ansätze erfordern jedoch eine sorgfältige Abstimmung mit weiteren therapeutischen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Behandlung effektiv bleibt und nicht durch intrafamiliäre Konflikte behindert wird.
Gruppentherapien bieten eine wertvolle Ergänzung, da sie soziale Interaktionen fördern und das Angstverhalten normalisieren können, insbesondere bei Kindern mit sozialen Ängsten. FALLSTUDIE 1 EMETOPHOBIE (ANGST VOR ERBRECHEN)
Lena (Name geändert), zehn Jahre, hat eine extreme Angst davor, sich zu übergeben. Die Phobie begann mit einer Magen-Darm-Grippe im Alter von sieben Jahren. Sie meidet seitdem bestimmte Lebensmittel, isst oft nur kleine Portionen und vermeidet jegliche Schulveranstaltungen, aus Angst, dass jemand erbrechen könnte. Ihre Eltern berichten, dass sie Panik bekommt, wenn sie von Übelkeit hört.
DIAGNOSTISCHE KRITERIEN
Lena erfüllt die Kriterien für eine Emetophobie, da die Angst übermäßig stark ist, zu erheblicher Vermeidung führt und ihren Alltag massiv beeinträchtigt.
INTERVENTION (s. auch QR-Code)
Ressourcenübungen: Anker setzen, Ressourcenschatzkiste erstellen, Ressourcenring (Angstring mit Perlen, auf jede Perle eine Ressource „setzen“)
Psychoedukation und Kognitive Verhaltenstherapie (KVT): Erklärungen zu Übelkeit, Körperreaktionen und dass Erbrechen eine natürliche Schutzfunktion ist
An Modellen eines Gehirns, Funktionsmodell Schluckvorgang, Bilder Körperbau Mensch, Vorgänge im Körper erklären
Exposition in sensu und in vivo: Erst Konfrontation mit dem Wort „Erbrechen“, dann Simulationen (z. B. Bilder in kontrolliertem Setting), Fotobuch mit verschiedenen Bildern zum Thema Erbrechen (Comic bis hin zu richtigen Fotos), jeweils ein Bild pro Seite und auf gegenüberliegender Seite die Möglichkeit auf einer Skala zu vermerken, wie schlimm der Anblick des Bildes ist. Während der Betrachtung mit einem Fingermassagering jeden einzelnen Finger abrollen – reziproke Hemmung oder bilaterale Stimulation (Kombination verschiedener Methoden). Später gezielte Exposition mit Situationen, die Übelkeit auslösen könnten.
Achtsamkeits- und Atemtechniken: Erlernen von Methoden, um sich bei ersten Anzeichen von Angst zu beruhigen FALLSTUDIE 2 SOZIALE PHOBIE
Tom (Name geändert), 14 Jahre, vermeidet soziale Situationen, in denen er im Mittelpunkt stehen könnte. Er hat Angst, sich zu blamieren oder negativ bewertet zu werden. In der Schule meldet er sich nicht, obwohl er die Antworten kennt, und er verweigert Gruppenaktivitäten.
DIAGNOSTISCHE KRITERIEN
Tom erfüllt die Kriterien für eine soziale Angststörung, da er eine ausgeprägte Angst vor Bewertung hat, die zu Vermeidungsverhalten führt und seinen Alltag einschränkt.
INTERVENTION (s. auch QR-Code)
Ressourcenübungen: Anker setzen, Ressourcenschatzkiste erstellen, Ressourcenring (Angstring mit Perlen, auf jede Perle eine Ressource „setzen“) Psychoedukation: am Gehirnmodell erklären, wo die Angst „wohnt“ und weshalb diese „übertreibt“ und weshalb sie auch wichtig ist
Soziales Kompetenztraining: Rollenspiele zur sicheren Kommunikation und zum Umgang mit unangenehmen Situationen
Kognitive Umstrukturierung: Veränderung von Gedanken wie „Alle lachen mich aus“ zu „Die meisten interessieren sich nicht so sehr für mich, wie ich denke“. - „Gutes Bild vs. schlechtes Bild“ – kreative kombinierte Methode – es wird ein Bild der stark belastenden Situation gemalt und ein Bild einer schönen Situation
- Ein Bild wird links und ein Bild rechts vom Kind aufgestellt. Während das Kind seinen Kopf in einer neutralen Position hält, erfolgt die bilaterale Stimulierung durch die Augenbewegungen. Die Augen bewegen sich abwechselnd nach links und rechts (von Bild zu Bild), um die emotionale Belastung zu verringern. Sobald sich am schlechten Bild etwas verändert, wird dieses neu gezeichnet bzw. verändert. Das wird wiederholt, bis die Belastung geringer ist.
Expositionsübungen: erst Simulationen, dann schrittweise reale Konfrontation mit sozialen Situationen (z. B. eine Frage im Unterricht stellen)
Entspannungstechniken: Progressive Muskelentspannung zur Reduktion körperlicher Angstsymptome, Atemtechniken einüben
Elternarbeit: Anleitung der Eltern, Tom nicht zu überbehüten, sondern ihn in sozialen Herausforderungen zu ermutigen. Erstellen eines Verstärkerplans (Mutkette etc.)
FAZIT
Da spezifische Phobien bei Kindern und Jugendlichen eine bemerkenswerte Prävalenz aufweisen und unbehandelt schwerwiegende Konsequenzen für die psychische Entwicklung, das soziale Leben und die schulische Leistung nach sich ziehen können, ist die Thematik in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen von hoher Brisanz.
Die KVT gilt als besonders effektive Behandlungsmethode, insbesondere durch den Einsatz von Expositionsverfahren und kognitiver Umstrukturierung. Die Integration traumafokussierter Ansätze, insbesondere bei Phobien, die durch belastende Lebensereignisse entstehen, hat sich ebenfalls als vielversprechend erwiesen. Zudem beeinflussen elternbasierte Interventionen, die auf die Stärkung der elterlichen Unterstützung abzielen, den Therapieerfolg der Kinder maßgeblich. Diese Ansätze schaffen nicht nur ein unterstützendes familiäres Umfeld, sondern tragen auch zur Reduzierung elterlicher Belastungen bei. Systemische Interventionen und Gruppentherapien erweitern das Spektrum an Möglichkeiten und bieten insbesondere im sozialen Kontext Vorteile, auch wenn sie nicht die gleiche Flexibilität wie Einzeltherapien bieten.
Während die KVT weiterhin als Goldstandard gilt, ergänzen neuere Ansätze wie die TF-KVT und elternintegrierte Verfahren effektiv das therapeutische Spektrum und adressieren spezifische Bedürfnisse von Kindern mit traumatischen Erfahrungen. Als Therapeut bedarf es eines tiefen Verständnisses für die Komplexität psychischer Störungen im Kindesalter und damit einhergehend bedarf es Wissen über verschiedene Therapieverfahren, die gut kombiniert werden können.

Monika Wahle
Klinische Psychologin, Traumatherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Praxis in Esslingen/Neckar

Christina Grünig
Förderpädagogin, Traumatherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Praxis in Limburg/Lahn
Die Autorinnen haben sich auf die Therapie von Angststörungen und Traumata von Kindern und Jugendlichen spezialisiert.