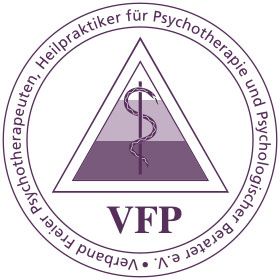Teil 1 - Chatbots, Hirnchips und die Zukunft der Psychotherapie
Kollabiert die menschliche Psychotherapie? Machen Chatbots und Hirnchips Psycho- therapeuten überflüssig?
Einige Gedanken zum Status quo und zur absehbaren Zukunft der therapeutischen Interaktion von Mensch und Digitalem.
CHATBOTS GEHÖRT DIE ZUKUNFT IN DER PSYCHO-THERAPIE
„Chatbots gehört die Zukunft“, wird der Psychologe Stefan Lüttke von der Universität Greifswald in einem Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 4.6.2025 zitiert. Darüber findet sich ein Artikel von Charlotte S. Schell mit dem Titel „Das lange Warten“. Der Kontext ist gesetzt: Wer nicht lange auf eine psychotherapeutische Begleitung warten möchte, kann aus inzwischen recht zahlreichen digitalen Angeboten auswählen. Zur Auswahl stehen sowohl klinisch geprüfte Programme, die als Medizinprodukt zugelassen sind und zum Teil von Krankenkassen unterstützt werden, sowie frei auf dem Markt verfügbare. Manche sind hybrid angelegt, als Kombination von Mensch und Programm; andere bieten rein digitale Hilfe an.
CHATBOTS ALS ALLEINIGE PSYCHO- HELFER DER ZUKUNFT?
Herr Lüttke antwortet auf die Frage, ob digitale Programme „Therapieplätze teilweise ersetzen“ können, mit einem „Ja“. Die Affirmation bezieht sich (noch) auf ausgewählte Störungskreise und wird begründet mit dem Verweis auf die zeitliche Flexibilität, mit der die Programme genutzt werden können, sowie mit der motivierenden Effektivität von Pushnachrichten, Nachfragen, Erfolgserlebnissen und erfreulichen Belohnungssystemen.
Primär beruhen die Angebote auf behavioristischrational-emotiven Modellen. Es handelt sich um vorzugsweise pragmatisch ausgerichtete Modelle. Das genügt zumindest in zahlreichen Fällen auf der reinen Handlungsebene mit dem Fokus, recht rasch das Wohlbefinden auf der emotionalen Ebene zu verbessern und Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. Unabhängig vom Modellbias und wie man ihn beurteilt: Dass primär verhaltenspsychologische Ansätze digital verarbeitet werden, liegt an der relativen Einfachheit ihrer Übersetzbarkeit in Formeln, Codes, Konditionalprogramme sowie an den rasch eintretenden Erfolgserlebnissen, die das subjektive Befinden verbessern. Begünstigt wird dies offenbar, wenn das digitale Format menschliche Therapeuten involviert. Dennoch: Die empirische Datenlage legt rasche Wirksamkeit auch rein digitaler Hilfestellung nahe, jedenfalls so lange, wie der Betroffene am Ball, in der Interaktion mit dem Programm/Chatbot bleibt, die Feedbackschlaufen funktionieren.
Indes: Bis dato werden rein digitale therapeutische Begleitungen offenbar öfter abgebrochen als hybride bzw. rein menschliche. Das wird gängigerweise mit dem Hinweis darauf erklärt, dass der Klient/Patient allein mit Programm (Chatbot, Avatar etc.) ist und das soziale Moment ausbleibt. Dies betrifft das motivationale Moment: Motivierung und Motivation durch unmittelbares Gespräch sowie Feedback bzw. Kontrollschleifen und – im Fall von Gruppentherapien – den sozialen Vergleich. Mithin das direkte, spontane Miteinander von Therapeut/Klient bzw. Therapeut/ Klient/Gruppe.
SETTING UND INSZENIERUNG ÄNDERN SICH, DAMIT AUCH DER STELLENWERT VON BEGRENZUNGSARGUMENTEN
Ändern sich die Rahmenbedingungen des hybriden bzw. rein digitalen therapeutischen Settings bereits, sodass das vermeintlich Defizitäre im rein digitalen Setting mit programmierter Ausgefeiltheit allmählich verschwindet?
Es scheint so, und dabei scheint der wirkungsmächtigste Faktor die Zugehörigkeit zu Generation/Alterskohorte und deren Sozialisation, also das Lebensmilieu zu sein. Es dreht sich alles um die Vertrautheit mit digitaler Technik und um das Zu- und Vertrauen in digitale Seelenbegleiter.
Psychologe Stefan Lüttke sieht den Weg zum Ersatz von menschlichen Therapeuten durch Chatbots und Programme, indem diese verbessert, das bedeutet: an menschliche Eigenheiten/Charakteristika und Bedürfnisse, insbesondere an motivationspsychologische Kenntnisse angepasst werden. Die Verbesserungen sollen dafür sorgen, dass Vertrauen und Effektivität gesteigert werden, vermittelt durch Algorithmen, die psycho-pädagogische Erkenntnisse, Methoden, Technik in Analyse, Anweisung und Rückmeldung übersetzen, sodass die Compliance gestärkt wird – und im Gefolge die therapeutische Begleitung wirksam(er) wird.
Bis dato werden digitale therapeutische Begleitungen öfter abgebrochen, als menschliche.
Mit Blick auf eine „Metaanalyse zu depressiven und ängstlichen Kindern und Jugendlichen“ zeige sich bereits „kein Unterschied mehr zwischen begleiteten und unbegleiteten Programmen“ (zu klinisch geprüften Programmen verweist er auf das DiGA-Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukt, der KV-App-Radar, Mobile Health App Database der Universität Ulm).
Sollten diese Befunde an Anzahl zunehmen und belastbar sein, stellen sich selbst bei digital affinen Gruppen/Personen zwei Fragen: Kann Kindern und Heranwachsenden mittelfristig ganz ohne menschliche Intervention therapeutisch geholfen werden, genügt das Programm, der Chatbot? Und: Wie können sowohl andere Gruppen und Angehörige älterer Altersklassen erreicht werden?
Hier kommt der Geist Huizingas ins Spiel, der den Menschen als spielendes Wesen charakterisiert. Zugespitzt formuliert: Verhaltenspsychologie als Grundlage, kombiniert mit Vergnügen, Freude, Spannung und Erfolgen:
Kinder und Jugendliche, die digital affin und in der Lage sind, mit Programmen umzugehen, sollen mit Gamification im Prozess gehalten werden. Wie andere Spiele wirken diese Elemente in erster Linie motivational und Klienten werden mittels verhaltenspsychologischer Maßnahmen „im Spiel“ gehalten: mit Maßnahmen, die das Belohnungssystem und damit vorzugsweise Dopamin- und Serotoninausschüt-
tung provozieren, Nutzer in freudige Spannung und Erwartung versetzen: Was geschieht als Nächstes? Punktevergabe, Level-Wechsel und andere spielpsychologische Techniken führen, so die Annahme, zu höherer Nutzung und Effektivität. Befördert werden diese durch Pushnachrichten, also unaufgeforderte Aktionen seitens des Chatbots. Man kann als Beleg auf die Empirie verweisen, sei es im Bereich von Spielen, sei es in dem von Plattform(nutzung) oder bestimmten Facetten der sogenannten sozialen Medienangebote.
Gamification lässt offenbar sogar die „Verbindlichkeit“ (Compliance) wachsen. Das Gefühl der Verpflichtung erscheint indes nicht als eben dies, sondern eher eingehüllt in den Ehrgeiz, erfolgreich zu sein. Der Klient bleibt im Spiel durch den Sog des Spielerischen und seiner Charakteristika, transportiert dank der Erwartung, Spannendes und Aufregendes, emotional Berührendes, sozial Anerkanntes zu erleben, ferner gehören emotional befriedigende soziale Kontakte dazu, Erfolgserlebnisse – schlicht, all das, was die Ausschüttung von Dopamin, Serotonin, Oxytocin fördert. Für Verbindlichkeit sorgt folglich weniger ein Konzept reflektorischer, durch Denken hergestellte Verbindlichkeit, sondern eine spannende, vergnügliche, Erfolgserlebnisse versprechende Inszenierung therapeutischer Interaktion.
Kann Kindern mittelfristig ganz ohne menschliche Intervention therapeutisch geholfen werden – genügt das Programm oder der Chatbot?
THERAPEUTISCHES GAMIFICATION UND SUCHTVERHALTEN
Kann die so hergestellte Verbindlichkeit zu einem süchtigen Verhalten führen, mit ähnlichen Erscheinungsformen wie etwa die Spielsucht? Das wäre nichts Neues.
Bereits vor Jahrzehnten stellte ich die Frage nach dem Suchtfaktor von Psychotherapie im Rahmen des Psychobooms ab den 1970er-Jahren. Sie war zu bejahen. Das Risiko erhöht sich für jene, die spielaffin sind, und für Menschen, die im Rahmen ihrer beruflichen und privaten Lebensführung mit spielpsychologischen Usancen (bewusst oder unbewusst) vertraut sind. Die Frage nach einer durch Gamification angereicherten bzw. deklinierten Therapie induzierten oder verstärkten Sucht ist brisant. Das Risiko wächst mit Gewöhnung an und Kompetenzgewinn in der Nutzung digitaler Angebote, insbesondere in den oben genannten Bereichen, die die Ausschüttung von Endorphinen und Dopamin befördern.
Soziokulturelle Habituierung, quasi das Aufwachsen mit Digitalmedien und deren Nutzung, lässt im besten Fall, sowohl Anwendungskompetenzen wachsen als sie auch das Fundament bereitet, psychische Abhängigkeit auszubilden (siehe zahlreiche Studien etwa zum Gebrauch des Smartphones). Prägen Spiele und Social Media den Alltag und treffen Hilfesuchende auch in der Psychotherapie auf gamifizierte Designs, steigt das Suchtrisiko notwendig eklatant
an. Außerhalb des therapeutischen Bereichs wird dies seit Jahren für Spiele und Social-Media-Nutzung empirisch belegt.
Vermutlich wird dies zu einem Alltagsphänomen werden. Denn auch auf beruflichen Feldern befindet sich der Einbau gamifizierter Elemente im Aufwind; keinesfalls nur, um junge Menschen für eine Ausbildung zu gewinnen, sondern ebenfalls im Ausbildungscurriculum sowie – zunehmend – in den beruflichen Alltag eingewoben, als Weiterbildung, Fortbildung, kurz: Qualifizierung.
Pointiert formuliert kann man von einer weitflächigen Anwendung verhaltenspsychologischer Konditionierung sprechen, in deren Zentrum Belohnung, Spannung und Erfolg, Wettbewerb, Erfolgserlebnisse, insgesamt Vergnügen an Zielerreichung, Ehrgeiz weckenden und Motivation hochhaltenden Elementen. Dies angenommen, kann man abwinken: Wenn diese Art von Konditionierung allgegenwärtig ist, einschließlich Suchtphänomen, dann entdramatisiert sich die Frage nach Therapiesucht enorm.
Einerseits ja, da zunehmend ein Alltagsphänomen. Andererseits sollten Therapeuten die Augen offenhalten, zumindest in der konkreten Therapie die Möglichkeit mitlaufen lassen. Ob sie sie nutzen oder sich bemühen, ihr entgegenzutreten im Rahmen der Devise „Hilfe zur Selbsthilfe“ muss dem persönlichen Ethos überlassen bleiben, zuweil auch der Wahl der maßgeblichen Theoriereferenz. (Es gibt psychologische Theorien/Modelle mit weniger und mehr Potenzial, Sucht zu evozieren.) Sucht nach positiven Gefühlen kann unterschiedlich befriedigt werden; Sucht nach dem Gespräch mit, der Begleitung von Therapeuten zeigt eine spezifische Abhängigkeit, die zudem durch gamifizierte Elemente in bestimmten Konstellationen wächst, wie oben skizziert.
Teil 2 folgt
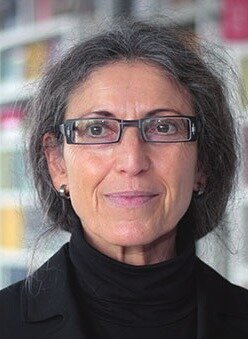
Dr. rer. soc. M.A. phil. Regina Mahlmann
Coachin und Beraterin, Moderatorin und Trainerin, Autorin und Textcoachin