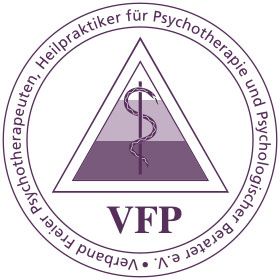Blinde Psychotherapeuten
ZWISCHEN UNSICHTBAREM UND INNERER KLARHEIT
„Wie kann das eigentlich gehen, Therapie ohne Blickkontakt?“ Diese Frage wird mir öfter gestellt. Mal neugierig, mal irritiert, manchmal auch bewundernd. Berechtigt ist sie auf jeden Fall, denn ich bin seit über 30 Jahren blind. Und ich arbeite psychotherapeutisch – mit Menschen, die sich zeigen, obwohl ich sie nicht sehen kann. Manchmal mache ich sogar die Erfahrung, dass sie meine Blindheit besonders anspricht.
Einmal nicht beobachtet werden; einmal nicht beurteilt werden; einmal einfach sein dürfen, ohne auf Äußerlichkeiten zu achten.
Als blinder Therapeut begegne ich meinen Klienten mit wachen Sinnen – nur eben anders als die meisten meiner Kollegen. Ich höre genauer hin. Ich spüre Pausen. Ich achte auf Atmung, Tonfall, Wortwahl. Und ich stelle fest: Das, was wir als nonverbale Kommunikation bezeichnen, ist so viel mehr als Mimik oder Gestik. Stimmung, Spannung, Resonanz – all das ist hörbar, fühlbar, manchmal fast greifbar.
Wenn ich einem Menschen gegenübersitze, „sehe“ ich ihn innerlich. Nicht nur als vorgestelltes Bild, sondern als atmosphärische Figur. Als Resonanzraum. Als Geflecht aus Worten, Gefühlen und Pausen. Ich arbeite mit Hypnose, ACT und systemischer Therapie. In allen drei Methoden spielt Präsenz eine zentrale Rolle – und diese Präsenz lässt sich wunderbar ohne visuelle Reize gestalten.
Wenn ich einem Menschen gegenübersitze, dann „sehe“ ich ihn innerlich.
Wie genau kann das aussehen? Natürlich verwende ich erst mal die gängigen Diagnosemethoden wie alle Kollegen Anamnesebögen, Fragebögen, persönliche Eindrücke aus unseren Interaktionen etc. Aber natürlich gibt es auch Herausforderungen. Ich kann keine Gesten deuten. Ich sehe nicht, ob jemand Tränen in den Augen hat. Aber ich spüre es im Bauch, ich höre es im Zittern der Stimme des anderen, im langen Ausatmen, im Schweigen. Und ich frage nach: „Mögen Sie mir vielleicht erzählen, was gerade in Ihnen vorgeht?“ oder: „Was würden diese Tränen mir jetzt sagen, wenn sie sprechen könnten?“ Das klingt vielleicht banal, aber gerade das Aussprechen dessen, was sonst unkommentiert bleiben würde, bringt oft eine ganz eigene Tiefe in den Prozess.
Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Klient, der ohnehin eine sehr ruhige Ausstrahlung hatte, wurde in unserem Gespräch ruhiger und ruhiger. Ich brachte meine Äußerungen stimmlich und von den Worten her auf die Emotionen, die ihn möglicherweise in diesem Moment bewegten. Überrascht fragte er mich: „Woher wissen Sie das jetzt?“, und er bestätigte, dass ihm gerade Tränen die Wangen herunterliefen. Das angebotene Taschentuch nahm er dankbar an. Solche Momente zeigen mir: Wahrnehmung ist nicht an Augen gebunden. Es braucht ein Gefühl dafür, in die feinen Zwischentöne hineinzulauschen. Und die entstehen auch oft jenseits des Sichtbaren.
Selbst in meinen Hypnosesitzungen, wo es viele gute optische Signale für Trancezustände gibt, habe ich ebenfalls sehr gute Wege über taktile Kontrollmöglichkeiten gefunden. Der Puls, der Muskeltonus, die Temperatur der Haut – alles präzise Anzeigen für die Tiefe der Trance.
ZWISCHEN BLINDENFÜHRHUND UND DSGVO
Mein Berufsalltag ist allerdings nicht nur Therapie, sondern auch Organisation. Als blinder Praxisinhaber arbeite ich am Computer mit einem Bildschirmvorleseprogramm und kompatibler Software. Meine gesamte Dokumentation läuft digital, barrierefrei, passwortgeschützt. Ich habe in vielen Stunden und aufwendigen Internetrecherchen Wege gefunden, DSGVO-konform zu arbeiten, ohne dabei auf persönliche Notizen oder individuelle Prozessgestaltung zu verzichten. Ein klares Fazit zu dieser Frage lautet allerdings: Es gibt viel zu wenig barrierefreie Software auf dem Markt, die uns blinde Therapeuten wirklich gut unterstützt. Es ist wie die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen – nur im Dunkeln. Zugegeben: Das schmerzt auch ein wenig. Denn es scheint hier ausschließlich um Gewinn durch massenmarkttaugliche Produkte zu gehen, während unsere therapeutische Arbeit auf Menschlichkeit fußt. Natürlich bringt die Praxisführung auch ihre ganz eigenen Herausforderungen mit sich: Handschriftlich ausgefüllte Anamnesebögen, digitale Bezahlmöglichkeiten, die mit dem Screenreader nicht zugänglich sind, oder besagte Patientenverwaltungssoftware, die mit Barrierefreiheit nicht viel am Hut hat. Ich muss oft improvisieren, technische Lösungen testen oder Prozesse kreativ umgestalten. Der Aufwand ist für mich also ungleich höher als für sehende Kollegen. Doch das ist der Preis, um selbstständig in eigener Praxis arbeiten zu können – und das ist es mir wert.
Und dann ist da noch Ella. Allein ihre Anwesenheit wirkt beruhigend oder anregend.
Und dann ist da noch Ella. Sie ist mein Blindenführhund und eine treue Begleiterin. In der Praxis liegt sie meistens entspannt neben meinem Stuhl. Manche Klienten sagen, allein ihre Anwesenheit wirke beruhigend. Oder anregend – je nachdem.
EIN ANDERER BLICK AUF VIELFALT
Was ich mir wünsche? Mehr Vielfalt im Berufsstand. Und ein tieferes Verständnis dafür, dass auch wir Therapeut:innen mit Einschränkungen einen wichtigen Beitrag leisten. Nicht trotz, sondern mit und manchmal auch wegen unserer Andersartigkeit. Wir bringen eine andere Perspektive mit – und vielleicht auch ein anderes Maß an Mitgefühl und Präsenz. Denn selbst mit einer einschränkenden Eigenschaft dauerhaft zu leben, wie ja auch viele unserer Klienten, schafft ein herzvolles Verständnis für die Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt.
Ich glaube, dass viele blinde Menschen ein besonders feines Gespür für atmosphärische Schwingungen entwickeln können. Vielleicht, weil sie von klein auf gelernt haben, mit inneren Bildern zu arbeiten. Vielleicht, weil sie sich nicht so sehr auf das Sichtbare verlassen können – und deshalb andere Antennen ausgebildet haben. Und vielleicht ja auch, weil sie oft versuchen, besser zu sein als ihre sehenden Mitbewerber, weil ihnen häufig aufgrund der Blindheit von vornherein ein gewisses Maß an Misstrauen bezüglich ihrer Fachkompetenz und Fähigkeiten entgegengebracht wird.
Ich selbst habe viele Jahre als Apple-Trainer mit kürzlich erblindeten Menschen in der Erwachsenenbildung gearbeitet. Ich habe erlebt, wie befreiend es sein kann, wenn gelernte Techniken nicht als Hürde, sondern als Werkzeug – als Weg aus dem Dunkel – verstanden werden. Diese Haltung nehme ich auch mit in meine therapeutische Arbeit: Es geht nicht darum, was fehlt, sondern darum, was noch möglich ist, wieder neu möglich sein kann. Diese Kernerkenntnis der ACT beflügelt nicht nur meine Klienten, sondern auch mich selbst immer wieder aufs Neue.
SCHLUSSGEDANKEN
Blindheit ist nicht romantisch. Und Therapie ist kein Zaubertrick. Aber beides kann – in Kombination – zu etwas sehr Echtem führen: zu einem Raum, in dem nicht das Sichtbare zählt, sondern das Spürbare. Vorausgesetzt, man gibt dieser Konstellation eine echte Chance.
Und manchmal, ganz manchmal, habe ich das Gefühl, ich „sehe“ heute viel mehr als früher, wenn auch mit völlig anderen Sinnen als mit den Augen.
Ich „sehe“ heute viel mehr als früher.

Jürgen Fleger
Heilpraktiker für Psychotherapie mit Praxis für Psychotherapie, psychologische Beratung und Coaching
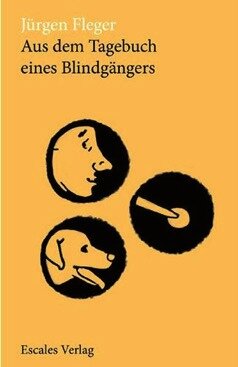
Jürgen Fleger: Aus dem Tagebuch eines Blindgängers. Escales Verlag, 2023