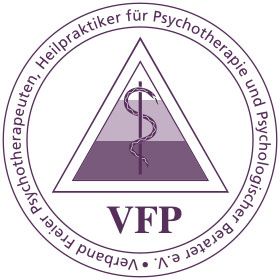Interkulturelle Sensibilität und das Selbstkonzept
In unserer Zeit der Globalisierung spielt interkulturelle Sensibilität auch im beruflichen Leben eine wichtige Rolle. So wird das Bennett-Modell eingesetzt, um Manager auszubilden und für internationale Geschäftsgespräche fit zu machen. Denn um Erfolg in einem anderen kulturellen Rahmen zu erzielen, benötigen diese Manager ein Interesse an anderen Kulturen, eine gewisse Sensibilität für die Einstellungen und das Verhalten, das durch diesen kulturellen Kontext des Geschäftspartners geprägt wird, um dieses direkt wahrzunehmen und entsprechend darauf reagieren zu können.
Es geht darum, dem Gegenüber und seinem kulturellen Hintergrund Respekt entgegenzubringen. Kulturelle Sensibilität steht für berufliche Effizienz und Erfolg. Wenn interkulturelle Sensibilität im Berufsleben so wichtig ist, ist sie dann nicht auch im Zusammenleben verschiedener Kulturen in einer Gesellschaft erstrebenswert und notwendig? INTERKULTURELLE SENSIBILITÄT VER-DEUTLICHT AM BENNETT-MODELL
Das Modell der Entwicklung interkultureller Sensibilität von Milton Bennett zeigt die verschiedenen Einstellungen zu kulturellen Unterschieden auf. Mithilfe des Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS) soll verdeutlicht werden, wie interkulturelle Sensibilität erworben werden kann und welche Bedeutung sie für das gesellschaftliche Zusammenleben hat. Die Kommunikation kann sich je nach kulturellem Hintergrund unterscheiden und dies führt manchmal zu Missverständnissen.
Den Fragen von Bennett habe ich noch acht weitere und eine offene Frage angehängt (1 = Sie stimmen überhaupt nicht zu, 2 = stimme nicht zu, 3 = stimme eher nicht zu, 4 = stimme eher zu, 5 = stimme zu und 6 = Sie stimmen sehr zu).
Die eigene Weltsicht bestimmt unsere individuelle Realität.
Das DMIS ist unterteilt in die ethnozentrischen und die ethnorelativen Phasen:
ETHNOZENTRISCHE PHASEN
Bei den ethnozentrischen Phasen gilt die „… eigene Weltsicht als zentral für die Realität“. Wenn alles nur durch die eigene Weltsicht beurteilt wird, wird alles, was anders ist, schnell als negativ eingestuft. So können Vorurteile und Rassismus entstehen. Leugnung (Denial):
- Die höchste Form der ethnozentrischen Phasen.
- Diese Personen separieren sich von Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund. - Unterschiede werden wenn überhaupt nur stereotyp wahrgenommen. - Die Unterschiede werden nicht als bedrohlich eingestuft, aber Menschen einer anderen Kultur wird ein niedriger Status zugesprochen.
Abwehr (Defense):
- Angst, dass durch kulturelle Unterschiede die eigene Realität infrage gestellt werden könnte. - Negative Stereotypisierung, denn negative Eigenschaften werden der fremden Gruppe zugeordnet und positive nur der eigenen Gruppe.
- Im Gegensatz zur Phase der Leugnung werden hier die kulturellen Unterschiede wahrgenommen.
Minimisierung (Minimization):
- Ist die letzte ethnozentrische Phase.
- Die kulturellen Unterschiede werden minimiert.
- Die Weltsicht wird nicht bedroht, indem die Gemeinsamkeiten der Kulturen hervorgehoben werden. - Was die Minimisierungsstrategie ethnozentrisch macht, ist die naive Annahme, dass – obwohl Unterschiede wahrnehmbar sind – diese nur wenig Bedeutung hätten, da im Grunde „alle Menschen gleich“ seien.
ETHNORELATIVE PHASEN
Hier werden die Kulturen in Bezug zueinander wahrgenommen. Dabei gilt die eigene kulturelle Sicht auf die Welt nicht als wahrer als die einer anderen Kultur. Akzeptierungsphase (Acceptance):
- Hier findet der Wechsel von der ethnozentrischen zur ethnorelativen Wahrnehmung von kulturellen Unterschieden statt.
- Es werden kulturelle Unterschiede akzeptiert und respektiert.
- Allerdings sind diese Personen noch nicht in der Lage, interkulturell zu handeln.
Adaptionsphase (Adaptation):
- Ab jetzt kann auch ethnorelativ gehandelt werden.
- Die eigene und andere Kulturen werden respektiert.
- Es entwickeln sich Verhaltensweisen zum interkulturellen Handeln.
Alle Kulturen werden respektiert.
Integration (Integration):
- Es ist jetzt möglich, sich unterschiedlichen Kulturen anzupassen.
- Dabei sind die Personen engagiert, die Kultur des Aufnahmelandes anzunehmen und gleichzeitig ihre Herkunftskultur zu behalten.
- Sie durchlaufen einen ständigen kulturellen Prozess. - Die Personen überlegen genau, welches Handeln in welcher kulturellen Situation geeignet ist.
- Dabei wird die andere Kultur nicht abgewertet und die eigene Kultur nicht aufgewertet.
- „Diese Personen kämpfen um die Integration der vollständigen Ethnorelativität und befinden sich außerhalb bestehender kultureller Bezugssysteme“.
Die ethnozentrischen und ethnorelativen Phasen bauen aufeinander auf. Der höchste Grad der interkulturellen Sensibilität ist die Integration. Diese Stufe erreichen Kinder, deren Eltern verschiedene Migrationshintergründe aufweisen, und Menschen, welche in mehreren Kulturen zu Hause sind.
Das Developmental Model of Intercultural Sensitivity bietet sich an für systematische Verhaltensbeobachtungen, aber auch um die interkulturelle Sensibilität zu erfassen. Daraus könnten Coachings und Weiterbildungen entwickelt werden. Es sollte Bestandteil bei Therapieangeboten sein. Sowohl für das globalisierte Weltgeschehen und alle beruflichen Verhandlungen müsste es ein Fach in der Schule geben, welches interkulturelle Sensibilität und globales Denken ausbildet.
Weitere Ziele dieses Schulfaches wären die Stärkung von Empathie, Selbst- und Attributionskonzepten. Diese Schlüsselkompetenzen sollten schon im Kindergarten-, Grundschul- und Schulalter vermittelt werden.
SELBSTKONZEPT UND KULTURELLER HINTERGRUND
Person und die soziale Welt wahrgenommen, analysiert und erinnert“ (Aronson et al.). Hieraus ergibt sich die Frage, ob ein Zusammenhang von Selbstkonzept und Kultur besteht. „Man wird in eine Kultur hineingeboren, wenn man aufwächst, werden einem Regeln und Normen beigebracht und man lernt, wie die Realität, die unsere Kultur definiert, gesehen und bezeichnet werden kann. Die Kultur ist somit eine der umfassendsten ‚Situationen‘, die auf unser tägliches Leben einwirken“ (Aronson et al.). Mit dieser Frage beschäftigt sich Shinobu Kitayama in der Studie des „framed line test“.
STUDIEN VON KITAYAMA: RAHMEN-LINIEN-TEST (FRAMED-LINE-TEST) IN JAPAN UND DEN USA STUDIE 1
Kognitive Aufgaben: Framed-Line-Test
Probanden sollten - Linie innerhalb des Rahmens (90 mm) ansehen.
- Die Linie war 30 mm lang und befand sich im oberen Drittel des Rahmens. - Danach sollten sie auf die andere Seite des Raumes gehen. - Hier erhielten sie die zweite Aufgabe, bei der sie selbst die Linie in den Rahmen zeichnen sollten. - Absolute Aufgabe: Die Linie sollte exakt 30 mm lang sein, unabhängig vom Rahmen.
- Relative Aufgabe: Die Linie sollte im Verhältnis zur Rahmenhöhe (ein Drittel der Rahmenhöhe) gezeichnet werden. - Schließlich wurde die Länge der gezeichneten Linien mit der vorgegebenen Linie verglichen, um die Genauigkeit zu bestimmen.
Ergebnisse:
Japanische Probanden waren bei der relativen Aufgabe (im Verhältnis zur Rahmenhöhe) genauer. Amerikanische Probanden waren bei der absoluten Aufgabe (exakte Länge) präziser. Geschlecht und Aufgabenreihenfolge hatten keinen Einfluss auf die Ergebnisse. STUDIE 2
Kognitive Aufgabe:
- Alle wurden mit dem Framed-Line-Test getestet, wobei die Tests in ihrer Muttersprache bzw. in Englisch durchgeführt wurden.
Ergebnisse:
- Amerikaner, die in Japan lebten, zeigten Lösungen, die mehr den japanischen Probanden in Japan ähnelten, also eine Tendenz zu den japanischen Denkweisen aufwiesen. - Japaner, die in den USA lebten, zeigten Lösungen, die mehr den amerikanischen Probanden in den USA entsprachen. - Das bedeutet, dass sich die kognitiven Fähigkeiten der Probanden an die Kultur anpassen können.
Kultur ist eine der umfassendsten Situationen, die auf unser Leben einwirken.
Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.
- Allerdings erschwert die unterschiedliche Aufenthaltsdauer die endgültige Interpretation, da unklar ist, ob die Anpassung nur vorübergehend ist. - Auch in Studie 2 gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
Festgehalten werden kann: Beide Studien zeigen auf, dass verschiedene Kulturen verschiedene kognitive Fähigkeiten aufweisen. Menschen nehmen den Kontext wahr oder ignorieren diesen. Somit beeinflusst die Kultur die kognitiven Fähigkeiten. Personen mit Migrationshintergrund sind in der Lage, ihre kognitiven Fähigkeiten der Aufnahmekultur anzupassen. In westlichen Ländern stehen das Individuum und die Einmaligkeit jedes einzelnen Menschen im Vordergrund. Menschen in westlichen Ländern definieren sich selbst über ihre eigenen Gedanken, Gefühle, Handlungen und richten sich dabei nicht nach anderen Menschen. Diese Unabhängigkeit kann mit der einzelnen Linie gleichgesetzt werden.
Hier liegt die Ursache darin, dass die Amerikaner den Rahmen und somit den Kontext ignorieren und sich nur auf die Linie konzentrieren. Schüler lernen in Amerika, dass sie selbst etwas für ihren Erfolg tun müssen, da dieser nur in ihren Händen liegt. Ihre Erfolge erzielen sie durch ihre Intelligenz oder ihr Talent. Dies verdeutlicht das Sprichwort „Jeder ist seines Glückes Schmied“.
In asiatischen Ländern steht die Gemeinschaft im Vordergrund. Menschen aus asiatischen Kulturen sprechen von sich nicht in der Ich-Form, wenn sie sich selbst beschreiben. Sie definieren und beschreiben sich über ihre Familien oder sozialen Gruppen, welchen sie angehören. Dies findet sich auch in der konfuzianischen Tradition, denn in dieser gibt es einen „… Gemeinschaftsmenschen (qunti de fenzi) oder ein soziales Wesen (shehui de renge)“. Sie gehen davon aus, dass ihr Verhalten und ihre Emotionen von anderen Menschen bestimmt werden. Für diese Menschen steht die Verbundenheit mit anderen Personen im Vordergrund, auch wenn dies eine gewisse Abhängigkeit mit sich bringt. Diese Art der Selbstsicht kann mit der Verbundenheit der Linie mit dem Rahmen gleichgesetzt werden, denn die Linie ist ein Teil des Rahmens. Deshalb nehmen die Japaner die Linie nur in Verbindung mit dem Rahmen wahr und somit den Kontext.
Das Streben nach Unabhängigkeit und Einmaligkeit werden in dieser Kultur als negative Charakterzüge angesehen. In der chinesischen Kultur sind Bescheidenheit und mit anderen Menschen in Harmonie zu leben wichtige Werte. Chinesischen Schülern wird früh beigebracht, dass nicht sie selbst für ihren Erfolg verantwortlich sind, sondern ihre Eltern oder die Lehrkräfte. Diese Zurückhaltung des eigenen Stolzes über die selbstständig erbrachte Leistung wirkt sich auf das Selbstkonzept und Attributionskonzept aus. Personen aus asiatischen Ländern spielen in der Öffentlichkeit und auch im privaten Umfeld ihre Leistungen herunter und reden diese klein.
Aus einer anderen Perspektive draufgeschaut, ist zu erkennen, dass sie ihre Leistung komplett ihrem Trainer verdanken und den Stolz auf ihn projizieren und dadurch ihren Erfolg feiern. Aber auch das Feiern der eigenen Leistung ist in asiatischen Ländern verpönt. Dies wird oft negativ ausgelegt. Bei Sportereignissen ist dies für westliche Zuschauer oft irritierend, warum die asiatischen Sportler sich nicht bejubeln und stolz feiern. Dies wurde beim Eiskunstlauf sehr deutlich. Eine Eiskunstläuferin freute sich so sehr über ihre Leistung und den Erfolg, natürlich nach westlichem Maßstab sehr verhalten, aber doch für uns bemerkbar und dies wurde als so süß empfunden, dass der Kommentator sich selbst so mitfreute und komplett entzückt von dieser Eiskunstläuferin war. Dies brachte uns die Persönlichkeit dieser Perfektionsläuferin näher und wir freuten uns alle mit ihr mit.

Oft steht in asiatischen Ländern, besonders in Japan und China, die Perfektion ganz weit vor den menschlichen Emotionen. In China wird das Selbstkonzept der Vorschulkinder durch das Geschichtenerzählen der Eltern beeinflusst. Die Geschichten beinhalten konfuzianische Traditionen, strenge Disziplin und soziale Verantwortung. Am Ende jeder Geschichte weisen Eltern darauf hin, wie wichtig es ist, dass die Familie in der Öffentlichkeit niemals ihr Gesicht verlieren darf.
Das Gesicht des anderen zu wahren, ist die wichtigste Verhaltensregel in China und die Bekundung des Respekts gegenüber anderen. Personen aus anderen Kulturkreisen tun sich oft schwer damit, zu erkennen, welche Verhaltensweisen einen Gesichtsverlust bedeuten könnten. „Infolgedessen findet sich in dem Selbstbild des chinesischen Kindes eine Betonung der Verantwortung gegenüber anderen Menschen, während sich das Selbstbild des amerikanischen Kindes unabhängiger darstellt“. Aus Sicht der Japaner gehört die Linie zum Rahmen und ist Teil des Ganzen.
„In der Tat sind diese Unterschiede im Selbstgefühl so fundamentaler Natur, dass es für Menschen mit einem unabhängigen Selbst ausgesprochen schwierig ist, abzuschätzen, wie es wäre, ein interdependentes Selbst zu haben und umgekehrt“ (Aronson et al.). Die Kultur, in der wir aufwachsen und leben, wirkt sich auf das Selbstkonzept aus. Was von der gesellschaftlichen Kultur in einem Land als Norm festgelegt und akzeptiert wird, hat in einem anderen Land mit einer anderen Kultur ganz andere Normfestlegungen und damit verbundene Verhaltensweisen. Allerdings können kognitive Fähigkeiten bei Auswanderung der Aufnahmekultur angepasst werden.
Zu den Themen des kulturellen Einflusses auf das Selbstkonzept bedarf es mehr Forschung. Interessant wäre es, zu untersuchen, wie unterschiedlich sich die Aufgabenlösung der Personen aus der Aufnahmegesellschaft, der Personen mit unterschiedlichen Migrationshintergründen und bei Kindern aus binationalen Ehen darstellt. Hierbei stellt sich die Hypothese, ob Kinder aus binationalen Ehen und Personen mit Migrationshintergrund die absolute als auch die relative Aufgabe gleich gut lösen. Dies könnte damit begründet werden, dass sie sowohl die Herkunftskultur als auch die Kultur der Aufnahmegesellschaft verinnerlicht haben.
Die Erkenntnis, dass der kulturelle Hintergrund sich auf das Selbstkonzept auswirkt, ist nicht nur bei Geschäftsbeziehungen, Therapien, sondern auch für den Schulunterricht relevant. Denn diese Auswirkungen können zu Missverständnissen bei der Kommunikation, der Wahrnehmung der Aufgabenstellung und der Aufgabenbewältigung in der Schule führen. Hierbei wäre es wichtig, bei der Unterrichtsplanung und der Aufgabenstellung diese unterschiedlichen Perspektiven und Lösungsstrategien zu berücksichtigen. Dies wäre ein weiterer Aspekt, den Unterricht in Deutschland chancengerechter zu gestalten.
Das Gesicht des anderen zu wahren, ist eine wichtige Verhaltens- regel in China.

Sina Guettaf
Sportwissenschaftlerin, Pädagogin und freiberufliche Autorin
Das Selbstkonzept ist das Wissen von dem, wer wir sind, und schließt das Nachdenken über sich selbst mit ein. „Durch das Selbstkonzept werden die eigene