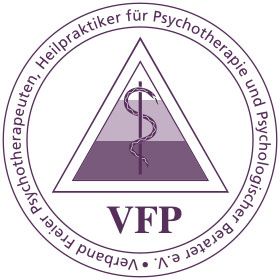Geld macht nicht glücklich - aber kein Geld macht krank
Je schwieriger die finanzielle Situation, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, eine psychische Störung zu entwickeln.
Dass Krisen - sei es die Coronapandemie, der Klimawandel oder der Ukrainekrieg – der psychischen Gesundheit der Menschen nicht zuträglich sind, ist bekannt und zeigt sich auch in den vollen Praxen der Heilpraktiker für Psychotherapie, der ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten. So lässt die anhaltende Wirtschaftskrise in Deutschland ebenfalls wenig Gutes erwarten. Und in der Tat zeigt sich: Es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen der individuellen finanziellen Situation und der psychischen Gesundheit.
Seit 1991 erfasst die R+V-Versicherung in ihrer Studie „Die Ängste der Deutschen“ die Themen, die den Menschen das größte Unbehagen bereiten und die meisten Sorgen machen. Auf Platz 1 finden sich auch in der neuesten Erhebung die gestiegenen (und womöglich weiter steigenden) Lebenshaltungskosten. Platz 2: 52% der Befragten machen sich ernsthaft Sorgen um adäquaten Wohnraum bzw. bezahlbare Mieten. Mulmig ist vielen Menschen (50%) auch beim Gedanken an weitere Steuererhöhungen oder Leistungskürzungen aufgrund der mauen Gesamtwirtschaft. Diese Verunsicherung wirkt sich nicht nur hemmend auf die Binnenkonjunktur aus (Stichwort Konsumlaune), sondern hat auch weitere volkswirtschaftliche Folgen.
Anders als die Bankenkrise um 2008 strahlt die kranke Wirtschaft konkret auf das Sicherheitsgefühl der meisten Menschen aus. Und Sicherheit, Verlässlichkeit, Vertrauen sind für Menschen essenziell. Massive Erschütterungen des Vertrauens sind potenziell traumatisch. Doch schon zunehmende Verunsicherung und ein anhaltendes Gefühl von Rat- und Hilflosigkeit bleiben nicht ohne Folgen, wie sich beobachten lässt.
So zeigt der Wirtschaftsphilosoph Matthew Ridley in seiner 2022 veröffentlichten Dissertation am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) einen deutlichen Zusammenhang zwischen den Finanzen und der psychischen Gesundheit auf. Danach treten Angststörungen und Depressionen bei Menschen mit niedrigem Einkommen 1,5- bis 3-mal so häufig auf wie bei Personen mit hohem Verdienst. Dieser Effekt dürfte sich umso stärker auswirken, je mehr Menschen sich fragen, ob und wie lange ihr Einkommen noch ausreicht, ob sie im Alter versorgt sind, sich einen Pflegeplatz oder das Taxi zum Arzt leisten können – sofern sie überhaupt noch einen Termin bekommen.
Die Angst vor Wohlstands- und Statusverlust erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Seele Schaden nimmt. Außerdem lösen Sorgen und Ängste Stress aus und steigern die Gefahr des Substanzmissbrauchs: Mit „Wer Sorgen hat, hat auch Likör“ lag Wilhelm Busch durchaus richtig. Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder solche, die vermehrt zu Alkohol und Drogen greifen, haben aber zunehmend Probleme, ihr Leben – und ihre Finanzen – im Griff zu behalten. Ein Teufelskreis.
Probleme im Umgang mit Geld sind kein neues Phänomen. Schon Anfang der 1990er-Jahre appellierten die Schuldnerberatungen, den Kindern und Jugendlichen in der Schule Grundwissen zum Thema zu vermitteln. Die politischen und gesellschaftlichen Ansprüche an die Schulen sind seit damals aber stetig weiter gewachsen – kein Wunder, dass die Pädagogen wenig Interesse und noch weniger Zeit haben, den Eltern auch noch die Vermittlung solcher „Basics“ abzunehmen. Andererseits sind aber viele Eltern selbst finanziell überfordert und nicht in der Lage, ihren Kindern einen gesunden Umgang mit Geld zu vermitteln.
Verlockende Finanzierungsangebote (jetzt kaufen – später zahlen), superbillige (Schrott-)Schnäppchen à la Temu & Co. und natürlich die bonbonbunte Welt der zahllosen Influenzer auf Instagram, Tiktok und ähnlichen Portalen machen es vielen, gerade jüngeren Menschen fast unmöglich, ein solides Gefühl für den Umgang mit Geld zu entwickeln. Spätestens, wenn das wahre Leben zuschlägt – etwa in Gestalt einer Mieterhöhung oder der kaputten Waschmaschine – wird die Lage schnell kritisch.
Die Schuldnerberatungen z. B. der Verbraucherzentralen helfen Überschuldeten, wieder einen Überblick über die eigene Finanzsituation zu bekommen und einen Weg aus der Schuldenfalle zu finden. Doch die Gründe für die Verschuldung liegen nicht immer in einer Trennung, einem Schicksalsschlag oder dem Verlust des Arbeitsplatzes. Häufig sitzen die Ursachen tiefer und vielen Menschen fehlt das Wissen über die inneren Faktoren, die sie in die Überschuldung getrieben haben. Bei Menschen, die bereits in der Überschuldung stecken, ist natürlich die Frage der
Kostenübernahme ein Problem, denn wer schon überschuldet ist, hat kaum noch Geld für einen helfenden Coach oder einen Heilpraktiker für Psychotherapie. Dabei wäre es wichtig, diese Personengruppe therapeutisch stärker zu unterstützen: Denn bis zu 80% der Menschen, die eine Schuldnerberatung aufsuchen, leiden an mindestens einer psychischen Erkrankung.
Die angespannte Wirtschaft und die wachsenden Sorgen immer größerer Bevölkerungsteile bedeuten in jedem Fall aber mehr Arbeit für die Heilpraktiker für Psychotherapie, für Coaches und Psychologische Berater. Sie können Betroffenen helfen, adäquat mit ihren Sorgen und Ängsten umzugehen, ehe diese sie krankmachen. Und sie können Menschen auch dabei unterstützen, die tieferen Ursachen ungesunden Konsums zu erkennen und das daraus erwachsende Bewusstsein zu entwickeln, nicht jeden Modetrend mitmachen zu müssen. Das kann sehr stärkend sein – zeigt sich gerade in diesem Bereich doch eine Selbstwirksamkeit, die sich buchstäblich auszahlt.
Angst vor Wohlstands- und Statusverringerung erhöht das Risiko, dass die Seele Schaden nimmt.

Jens Heckmann
Redakteur, Experte für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing