Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern in der Schule – Inklusion versus Resignation
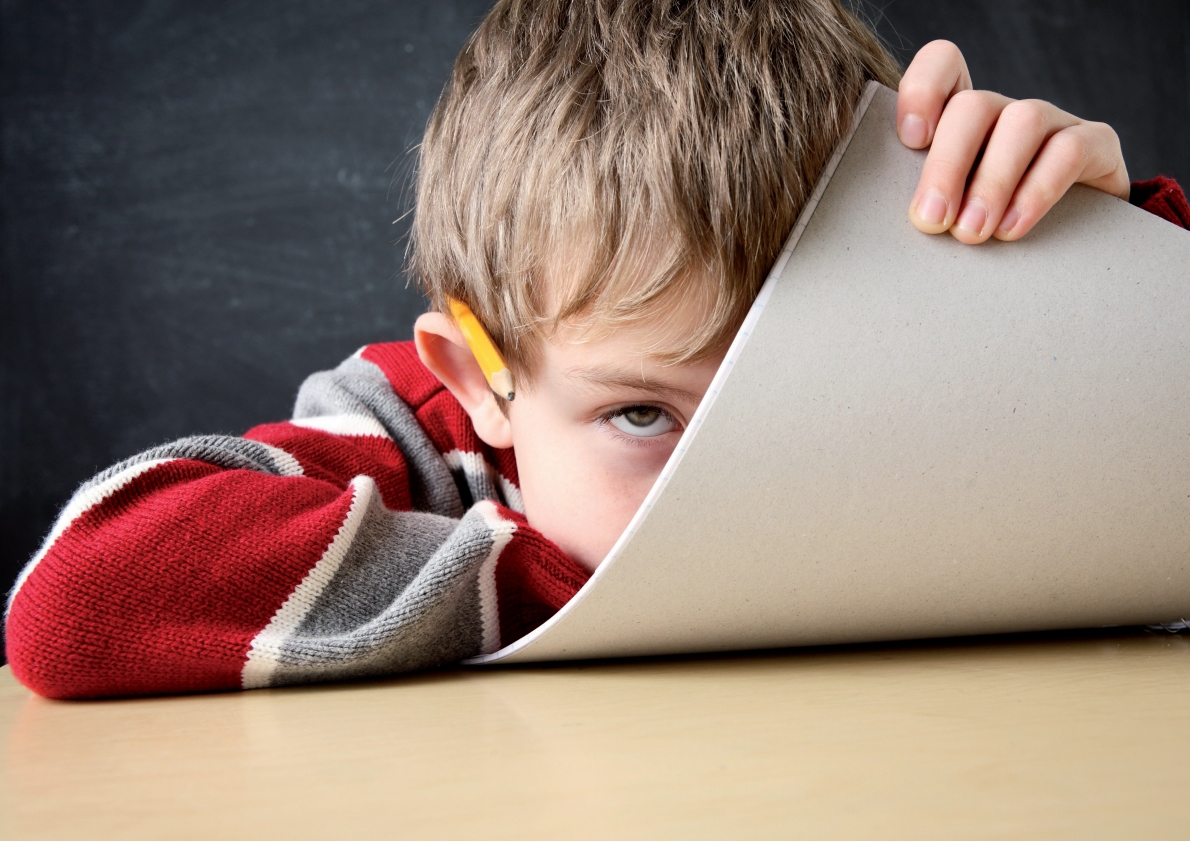 „Ob der Philipp heute still – wohl bei Tische sitzen will?" Also sprach in ernstem Ton der Papa zu seinem Sohn, und die Mutter blickte stumm auf dem ganzen Tisch herum. Doch der Philipp hörte nicht, was zu ihm der Vater spricht. Er gaukelt und schaukelt, er trappelt und zappelt, auf dem Stuhle hin und her. „Philipp, das missfällt mir sehr!“ …
„Ob der Philipp heute still – wohl bei Tische sitzen will?" Also sprach in ernstem Ton der Papa zu seinem Sohn, und die Mutter blickte stumm auf dem ganzen Tisch herum. Doch der Philipp hörte nicht, was zu ihm der Vater spricht. Er gaukelt und schaukelt, er trappelt und zappelt, auf dem Stuhle hin und her. „Philipp, das missfällt mir sehr!“ …
... wohlbekannt und tausendfach gelesen sind diese Zeilen. Bereits vor über 170 Jahren lieferte der Kinderpsychiater Heinrich Hoffmann mit seinem „Zappelphilipp“ eine illustrative wie treffende Charakterisierung einer schwerwiegenden kinder- und jugendpsychiatrischen Erkrankung: die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS).
Aber nicht nur Kinder mit dieser Erkrankung sitzen in unseren Klassenzimmern. Im Zuge der inklusiven Schule haben die Schüler mit diversen Beeinträchtigungen in kognitiven und körperlichen Bereichen im Regelschulwesen rasant zugenommen. Im Kontext so eines Potpourris von Beeinträchtigungen in unseren Klassen ist es fast schon hämisch seitens der Politik, einzelne Schulen mit dem Label „Inklusionsschule“ auszuzeichnen. Da im 21. Jahrhundert mittlerweile jede Grund- und Mittelschule diesen Titel einer inklusiven Schule verdienen würde, weil ja nach dem Gedanken der Inklusion (lat. includere: einschließen) jeder das Recht hat – mit wenigen Einschränkungen – zunächst einmal in der Regelschule beschult zu werden. Damit befinden sich zwangsläufig in jedem Klassenzimmer der Regelschulen mehrere Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf.
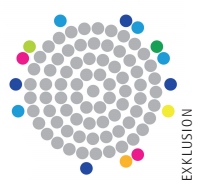 Die Schulberatungen erreichen seit der Umsetzung des Art. 24 der UN-Behindertenrechtskonvention zahlreiche zusätzliche Anfragen bzgl. Schülern, die intra- und interpersonelle Probleme haben. Aber die Gruppe an Schülern, die die größten Herausforderungen an die Pädagogen stellt, sind die Kinder mit Auffälligkeiten im sozioemotionalen Bereich. Schüler, die nicht still sitzen können, sich nicht eingrenzen lassen, starkes oppositionelles aggressives Verhalten zeigen und stellenweise sich selbst und andere gefährden. Was kann man mit dieser speziellen Gruppe an Schülern tun?
Die Schulberatungen erreichen seit der Umsetzung des Art. 24 der UN-Behindertenrechtskonvention zahlreiche zusätzliche Anfragen bzgl. Schülern, die intra- und interpersonelle Probleme haben. Aber die Gruppe an Schülern, die die größten Herausforderungen an die Pädagogen stellt, sind die Kinder mit Auffälligkeiten im sozioemotionalen Bereich. Schüler, die nicht still sitzen können, sich nicht eingrenzen lassen, starkes oppositionelles aggressives Verhalten zeigen und stellenweise sich selbst und andere gefährden. Was kann man mit dieser speziellen Gruppe an Schülern tun?
Beginnen wir mit den Grundlagen: dem schulrechtlichen Fundament
Aber da muss man leider viele Kollegen (immer m/w) am Telefon relativ schnell desillusionieren. Wenn das Commitment seitens der Eltern nicht gegeben ist, wird es auch für die Schule sehr schwierig. Natürlich darf und muss die Spannbreite der Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen voll ausgeschöpft werden: Mitteilung, schriftlicher/verschärfter Verweis, Versetzung in eine Parallelklasse, Ausschluss in einem Fach oder vom gesamten Unterricht etc. (BayEUG Art. 86).
Leider führen diese Maßnahmen nicht immer zu einer korrigierten Verhaltensmodifikation beim Schüler. Das Ausschöpfen dieser Maßnahmen – auch bereits in der Grundschule – ist aber trotzdem sehr wichtig, wenn es später um eine Umschulung in ein Förderzentrum oder um eine schnellstmögliche Einweisung in die Psychiatrie geht. Die erste Frage, die häufig seitens der Psychiater in der Klinik gestellt wird, ist: „Wurden alle schulischen Maßnahmen ausgeschöpft?“ Wird diese Frage verneint oder ist noch kein einziger Aktenvermerkt vorhanden, wird es schwierig.
 Wo wir gerade bei Einweisungen/Umschulungen sind: Eine Umschulung in ein Förderzentrum ohne Einverständnis der Eltern wäre theoretisch sogar möglich (geregelt in der GrSO § 5 – Überweisung an ein Förderzentrum), aber ob diese Maßnahme sinnvoll ist und ob sich das zuständige Förderzentrum damit einverstanden erklärt, steht auf einem anderen Blatt.
Wo wir gerade bei Einweisungen/Umschulungen sind: Eine Umschulung in ein Förderzentrum ohne Einverständnis der Eltern wäre theoretisch sogar möglich (geregelt in der GrSO § 5 – Überweisung an ein Förderzentrum), aber ob diese Maßnahme sinnvoll ist und ob sich das zuständige Förderzentrum damit einverstanden erklärt, steht auf einem anderen Blatt.
Summa summarum kann man das Fazit ziehen, dass Lehrkräfte durchaus rechtliche Maßnahmen durchführen könnten, um verhaltensauffälligen Schülern etwas entgegenzusetzen, aber die Möglichkeiten nur dann greifen, wenn die Eltern Commitment zeigen. Hier müsste seitens des Gesetzgebers eine Modifikation erfolgen, um Schulleitern und Lehrkräften ein größeres rechtliches Handlungsrepertoire an die Hand zu geben, damit sie nicht allein auf weiter (Schul-)Flur stehen.
Tipp: Man kann auch immer Kontakt mit dem zuständigen Jugendamt aufnehmen, falls ganz schwere Fälle elterlichen Fehlverhaltens vorliegen. Es besteht z. B. immer das Recht auf eine pseudonymisierte Beratung nach § 8b SGB VIII. Hier kann man sich Rat holen bzw. können die JA-Mitarbeiter einem auch das weitere Handlungsprozedere vorgeben.
Widmen wir uns nun dem nächsten Punkt: den strukturellen Maßnahmen
Sowohl die Ganztagesschule als auch die inklusive Schule brauchen eine speziell pädagogisch begründete Gestaltung und Ausstattung von Schulgebäuden – am besten barrierefrei mit vielfältigen Differenzierungsräumen für Einzel- und Gruppenarbeiten sowie mannigfachen Fachräumen. Aber gerade an der Ausgestaltung der baulichen Voraussetzung scheitert es häufig vor Ort, obwohl es für die politischen Mandatsträger genügend Anregungen seitens der Wissenschaft (z. B. die Lernhauspädagogik) oder der Berufsverbände (BLLV-Broschüre: Schulen pädagogisch bauen) geben würde.
 Eine Maßnahme, die man relativ schnell und unkompliziert umsetzen kann – man benötigt lediglich einen freien Raum – ist die Trainingsraum-Methode (Bründel, H. und Simon, E., 2013). Der Trainingsraum ist ein Klassenzimmer für diejenigen Schüler, die im Unterricht stören und sich nicht an die geltenden Regeln halten wollen oder können. Schülern, die kontinuierlich den Unterricht stören, wird so die Gelegenheit gegeben, in einem anderen Raum (unter Hilfestellung eines Lehrers/Sozialpädagogen) über ihr Störverhalten nachzudenken und zu anderen Einsichten zu kommen.
Eine Maßnahme, die man relativ schnell und unkompliziert umsetzen kann – man benötigt lediglich einen freien Raum – ist die Trainingsraum-Methode (Bründel, H. und Simon, E., 2013). Der Trainingsraum ist ein Klassenzimmer für diejenigen Schüler, die im Unterricht stören und sich nicht an die geltenden Regeln halten wollen oder können. Schülern, die kontinuierlich den Unterricht stören, wird so die Gelegenheit gegeben, in einem anderen Raum (unter Hilfestellung eines Lehrers/Sozialpädagogen) über ihr Störverhalten nachzudenken und zu anderen Einsichten zu kommen.
Die psychologischen sowie pädagogischen Vorteile liegen auf der Hand: Die Trainingsraum-Methode ist für Lehrer eine große Erleichterung und stellt zudem ein Prozedere zur Verfügung, mit dem man (ohne große Emotionalisierung) auf Störungen reagiert. Studien (Befragung von Lehrkräften und Schülern) in NRW mit über 100 Schulen ergaben eine sehr hohe subjektive Zufriedenheit und signifikante Verhaltensänderungen bei Schülern mit dem Programm (Balz, 2004). Anmerkung: In Gymnasien z. B. im Raum Oberbayern wird diese Methode schon seit Jahren praktiziert.
Nach dem rechtlichen Fundament sowie den strukturellen Maßnahmen kommen wir nun zu den naheliegenden Interventionen: den pädagogischen Möglichkeiten.
Wir Lehrkräfte sind gerade für solche Kinder ganz wichtige Bezugspersonen, die ihnen helfen, sie unterstützen, beraten, coachen und ihnen in schweren Zeiten Mut machen und Halt geben („eros paedagogicus“; Largo, 2009). Trotz allen Verständnisses für die Situation der Schüler muss jedoch der Grundsatz gelten: Jeder Lehrer und jeder Schüler hat ein Recht auf stö- rungsfreien Unterricht! Es gehört nämlich zu den elementarsten Pflichten eines Schülers, sich so zu verhalten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann (BayEUG Art. 56).
Neben den klassischen Maßnahmen, wie das Verteilen von gelben/roten Karten, Ausfüllen eines Nachdenkblatts usw., hilft gerade bei solchen Kindern, die stärkste Beeinträchtigungen im sozio-emotionalen Bereich aufzeigen, nur eins: eine zweite pädagogische Kraft im Klassenzimmer.
Dass der Lehrer sein Wissen wie die Sonne ihre Strahlen auf hundert Kinder verteilen kann, stimmte vielleicht zu Comenius` Zeiten im 17. Jahrhundert, als diese Kinder noch alle still saßen und den Lehrer respektierten. Bei den heutigen Schülerverhältnissen in manchen Klassen reicht das pädagogisch-didaktische Know-how einer einzigen Lehrkraft häufig nicht mehr aus. In solchen Klassen muss eine Entlastung der Pädagogen erfolgen.
Neben der Entlastung ist es auch für auffällige Schüler vorteilhaft, weil es ein zweites Regulativ zum Stammlehrer gibt und somit nicht nur die eine Lehrperson aversiv konnotiert wird. Hier möchte ich vor allem an die politisch Verantwortlichen appellieren, dass diese – neben der Einforderung von Beamtenpflichten – auch ihre Fürsorgepflicht gegenüber uns Lehrkräften wahrnehmen!
 Dr. phil. Alexander Prölß
Dr. phil. Alexander Prölß
staatlicher Schulpsychologe, Beratungsrektor, Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT), Kommunikations- und Konfliktmanagement, (Hypnose-)Coaching

