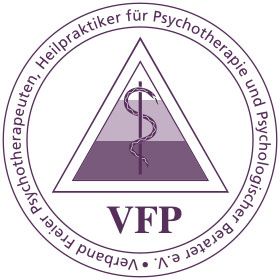Das Leben macht Spaß
SYSTEMISCH-KREATIVES ARBEITEN MIT ÄLTEREN MENSCHEN
Wann ist ein Mensch alt? Die WHO sagt, mit 75. Vorher, ab 60, ist man „älter“. Die Werbebranche macht bei 75 den Cut zwischen „Young olds“ und „Old olds“. Früher gehörte man mit 60 zum alten Eisen. Der Lebensabend begann mit dem Renteneintritt. Wer heute in Rente geht, hat oft noch eine längere aktive Phase vor sich, kann Freiheit und Unabhängigkeit genießen, sich neue Ziele stecken – wenn nicht die Altersarmut einen Strich durch die Rechnung macht. Oft genug wird sie in frohen neuen Blicken auf das „Golden age“ einfach vergessen.
Der Begriff des Alters ist im Wandel, 60 ist das neue 50 und so weiter. Unterdessen ist das höhere Alter nach wie vor meist negativ konnotiert. Verfall, Einschränkung, Einsamkeit, Demenz – nichts wird mehr besser. Die Forschung hat dieses Defizitmodell längst überholt. „Es konnte der Nachweis erbracht werden, dass der menschliche Organismus auch im hohen Alter sowohl im physischen als auch im psychischen Bereich Plastizität zeigt“, hieß es schon im 6. Bericht zur Lage der älteren Generation der Bundesrepublik Deutschland von 2010.
Unsere Narrative vom Alter beeinflussen unsere Wahrnehmung und unser Erleben. Je nachdem, wie wir in der Lage sind, unsere Bilder zu dekonstruieren, gelingt es uns, das Alter mit dem Blick des Wachstums und der Potenzialentwicklung zu betrachten. Und positive Einstellungen, Beziehungsvielfalt und soziale Teilhabe scheinen, so Thomas Friedrich-Hett in „Systemisches Arbeiten mit älteren Menschen“, vor körperlichem Verfall zu schützen und ein langes Leben zu begünstigen.
Zu den überkommenen Bildern vom Alter gehört auch die Annahme, Psychotherapie bei Älteren sei nicht sinnvoll, ja, nicht einmal durchführbar. Die erwiesene Neuroplastizität bis ins hohe Alter, die sich schon lange verändernden Lebensentwürfe – schlicht, die Realität – bestätigt: Es gibt Beweglichkeit, es gibt den Wunsch nach Entwicklung und es gibt die Fähigkeit dazu.
EIGENTLICH GEHT ES UM FÜLLE
Die Mutter meiner Sandkastenfreundin ist neulich 90 geworden. Über Jahrzehnte lebte sie mit ihrer Familie in Hannover. Seit Langem wohnen ihre Kinder in Berlin. Vor einiger Zeit starb ihr Mann, und die Mutter meiner Freundin, mit Mitte 80, zog nach Berlin. In eine eigene Wohnung. Sie geht nicht mehr viel aus dem Haus, ist im Kontakt mit der Welt über ihre Kinder und zwei dicke Tageszeitungen. Infekte, Stürze, Rückschläge meistert sie mit klarsichtiger Unverdrossenheit, mit beispielhafter Resilienz.
Meine Tochter hat ihr Freiwilliges Soziales Jahr in einem Altenheim in Costa Rica gemacht. Ich konnte sie dort besuchen und erleben, wie ein uralter blinder Herr, genannt „Mesjeh“, Monsieur, sich in die Mitte des Raums führen ließ, um dort zu tanzen – sicherheitshalber nur am Platz, aber mit einem unverkennbaren Rest von Hüftschwung und Latino-Esprit. Minimalistische Lebensfreude.
Vor der Pandemie hatte ich Gelegenheit, einen Film über das hohe Lebensalter1) zu drehen. Ich ging ins Altenzentrum, in private Haushalte, ins Pflegeheim. Ich traf auf Härte, Schmerz und Traurigkeit, aber auch auf Mut und Durchhaltewillen, Lustigkeit und Freude, Liebe, Verbundenheit und Hingabe. Daran zu denken, lässt mich heute noch erschauern.
"Ich bewundere sie, weil sie die Kraft, Klugheit, Gelassenheit, Liebe und den Humor haben, ihr Leben erfüllt zu gestalten."
Verglichen mit manchen Menschen in meinem Film sind die „Alten“ zwischen 70 und 80, die in meine Praxis oder Gruppen kommen, oft noch junge Hüpfer. Sie stellen sich – oft aus ganz eigenem Entschluss – neuen Herausforderungen. Oder alten Herausforderungen auf neue Weise. Sie sagen mir: „Wann, wenn nicht jetzt?“ Und das fühlt sich nicht an wie eine Neuauflage des alten Drucks, den wir uns schon immer gemacht haben. Vielmehr verstehe ich es als Gelegenheit, die Dinge neu zu sehen, neu zu bewerten, Druck aufzulösen, Freude zu spüren. Sich und die Welt noch mehr und tiefer zu akzeptieren. Eigentlich geht es um Fülle.
ICH HAB JA DEPRESSIONEN
Wer älter wird, hat früher oder später mit Einschränkungen zu tun. Nicht mehr auf den Berg wegen der Knie, im Winter nicht gern mehr raus wegen der Glätte. Nicht mehr kegeln gehen und abends nicht mehr ins Konzert. So manche meiner Gespräche mit älteren Menschen beginnen mit ihren Klagen über Einschränkungen. Oft aber wird auch nur konstatiert, wird der Herausforderung des Alters mit Disziplin begegnet: „Das ist eben so“. Dieser Disziplin ist es wohl auch zu verdanken, wenn die betreffende Person etwa ihren Tag strukturiert, jeden Morgen aufsteht, spazieren geht, sich etwas kocht, selbstwirksam und selbstständig im Leben bleibt: Kernkompetenzen zum Fern- oder Kleinhalten depressiver Stagnation. Was dennoch leicht eintreten kann, ist eine gedankliche Einengung, bei den psychischen Elementarfunktionen als formale Denkstörung verbucht. Störung? Es geht eben immer weniger! Diese Einengung ist ja eine sehr verständliche Reaktion auf objektiv messbare Vorgänge, vom Knieschaden bis zum Todesfall. In Gesprächen tritt oft Entspannung ein, wächst in kleinen Schritten das Vertrauen, wenn ich deutlich mache, wie sehr auch ich den Grund zur Klage sehe. Und dann kommt womöglich ganz von selbst ein Satz wie: „Aber dann mach ich mir an Kaffee und setz mich auf den Balkon, und dann is scho wieder bissl besser“. Selbsthilfemaßnahmen und Ressourcen? Da sind sie.
Kompetenzen, Ressourcen, Erfolge im täglichen Leben bewusst machen: Das gehört zu den vielen Freuden in solchen Gesprächen. Den Fokus von alten und aktuellen Unmöglichkeiten wegzulenken – zunächst nicht mal auf neue Lösungen, sondern auf bewährte, lang erprobte –, hat schon für allerhand Aufrichtung gesorgt, zu mehr Klarheit im Blick und in der Stimme und zu allerhand schönen Geschichten, mit Stolz erzählt.
Eine Geschichte, von Frau B., fängt zum Beispiel an mit „Also ich hab ja Depressionen, ne?“ Die erklärtermaßen depressive Frau B. macht sich aber auf die Socken in einen Münchner Vorort und fragt sich, beim Bäcker und beim Busfahrer, bis zu einer alten Arbeitskollegin durch, die sie damals so nett fand: „Das mach ich einfach, batsch!“ – Da gibt es die alte systemische Anekdote, wo der Patient sagt: „Ich hab Depressionen“, und der Therapeut fragt: „Wo sind die denn jetzt, haben Sie die mitgebracht?“ Frau B., die ihre nette Kollegin fand, hatte ihre Depressionen bestimmt zu Hause gelassen. Kluge Entscheidung.
PLAUDERND IN DIE TIEFE
Ich hätte noch viel zu berichten aus Einzelsessions in meiner Praxis, hier aber möchte ich nur von meiner Gruppenarbeit sprechen. Schon in meiner Mittwochsgruppe im Nachbarschaftstreff um die Ecke passiert so manches, was ich in meiner
war und ist es natürlich sehr viel expliziter, das wertschätzende Miteinander, die Kultur des Zuhörens, Spürens, Anerkennens und positiv Herausforderns. Allein der Name der Gruppe, Erzählcafé – Wikipedia „eine partizipative und interaktive Methode des autobiografisch orientierten Erzählens“ – ist eine Anpassung an Gewohnheiten in der guten Tradition des „Abholens“ möglicher Zielgruppen. „Café“ klingt irgendwie vertraut, und alles, was übers Erzählen hinausgeht, wird ganz informell, wie nebenbei, eingeführt. Und vor allem erzählen wir nicht nur. Wir erleben sehr viel.
Eigentlich habe ich jedes Mal zwei Konzepte in der Tasche. Das eine ist, wie es sich gehört, mit konkretem Ablauf und Thema: etwa das Verhältnis von Ich und Gemeinschaft, das bewusste Wahrnehmen des Augenblicks oder auch Veränderung und Wandel. Gemeinsam ist ihnen, dass ich sie spielerisch, praktisch und stark ressourcenorientiert angehe. Um die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen im Blick zu haben, sich also über sich selbst freuen zu können. Je eher ich übe, mich über mich selbst zu freuen, desto besser kann ich es, wenn es wirklich nötig ist. Das andere Konzept ist: kein Konzept. So wie ich als Musikerin mit den Kolleginnen und Kollegen improvisierend ins Gespräch komme, ergeben sich aus dem Geplauder der Teilnehmer Anknüpfungspunkte. Wäre ja auch merkwürdig, wenn das tägliche Leben nicht reichlich Anlass böte, auf wichtige Themen zu kommen. Das Besondere: Immer wieder, ganz nebenbei, wechseln wir auf die Metaebene, entdecken essenzielle Qualitäten, gehen mitten im Geplänkel unverhofft in die Tiefe.
Frau K., letztes Jahr 80 geworden, erzählt: Sie hat im Fernsehen in eine Yogasendung für Seniorinnen hineingezappt. Kurzentschlossen hat sie mitgemacht und sich vor dem Fernseher auf ein Bein gestellt. Direkt neben dem gläsernen Wohnzimmertisch. Dann ist sie umgekippt und übel auf den Tisch gefallen. Fiese Prellung an der Schulter und die Moral: Mach doch nicht so unbedacht irgendeinen Blödsinn mit. Gemeinsam konnten wir uns die Moral noch mal genauer anschauen. Die Yogasendung fand Frau K. gut, ihren Entschluss mitzumachen eigentlich auch. Das Einzige, was gefehlt hatte: ein Moment für die eigene Sicherheit. Irgendwo festhalten. Heraus kam die Erkenntnis, dass ihr schöner Impuls nur noch etwas Besinnung gebraucht hätte, um in einem schönen Erlebnis zu gipfeln. Eine Aktion, die leicht zur Selbstverurteilung wegen groben Leichtsinns hätte führen können, ergab nun Wertschätzung für die Initiative und freundliches Mitgefühl für die eigene Impulsivität. Zudem die Erkenntnis, dass Yoga vorm Fernseher realistisch und Freude versprechend ist – mit einem kleinen Haltegriff irgendwo. Also in der Summe eine Repertoireerweiterung. Und hinterher gab es einen klitzekleinen psychoedukativen Exkurs zum Thema Reframing.
DEM ZWECKDENKEN EIN SCHNIPPCHEN SCHLAGEN
Konzept hin oder her: Immer gibt es im Erzählcafé Elemente, die nichts mit Reden zu tun haben. Wir arbeiten zu Führen und Folgen mithilfe von Essstäbchen. Wir malen mit Buntstiften und erzählen uns etwas über unsere Bilder. Wir machen Musik mit Handglocken, spontan, mit und ohne Dirigieren. Wir geben Töne als Signale weiter und freuen uns, wenn das allmählich immer besser funktioniert. Wir lassen die Glocken weg und werfen uns Gesten und Laute zu. Das kann herrlich komisch werden und ist etwas, das im Alltag der Leute sonst nicht vorkommt.
Das alles ist mehr als einfach nur lustiges Spielen. Wir tun es exemplarisch für die unendliche Vielfalt, die einfach nur aus dem Zusammensein entsteht. Um dem Zweckdenken ein Schnippchen zu schlagen. Um mit einfachsten Mitteln den Reichtum des Daseins zu feiern. Um dem Funktionieren, das so leicht ins Nichtfunktionieren kippen kann, eine Alternative gegenüberzustellen. Und während wir lustig kichern, feuern die Synapsen genau das Richtige: Leben
"Je eher ich übe, mich zu freuen, desto besser kann ich es, wenn es nötig ist."
Ausbildung in Hamburg kennen- und schätzen gelernt habe. Dort
macht auch Spaß. Nicht vergessen. Wir blicken einander an, während ein Zimbelton in der Stille verklingt. Und wir summen miteinander. Das hat ein bisschen was von einer Nachtwanderung: leicht unheimlich und zauberhaft prickelnd.
Also, mein „Erzählcafé“ ist eher eine Sammlung aus Systemik, Achtsamkeit und anderen meditativen Impulsen, Wahrnehmungs- und Kommunikationstraining, musikalischen Spielen und Übungen. Und ganz besonders aus einer permanenten Lust am Crossover, am Spiel mit Grenzen. Wenn ich meine Realität als formbar empfinde – nicht nur über Veränderung äußerer Bedingungen, sondern vor allem über meine Wahrnehmung und mein Erleben – dann kann ich auf mich und mein Leben mit mehr Freude blicken. Virtuose Lebenskunst ist vielleicht, dies zu erreichen, ohne einen Finger zu rühren.
ICH HAB NICHT MEHR EWIG ZEIT
Ich kann nicht über das Alter schreiben und den Tod ausklammern. „Ich hab nicht mehr ewig Zeit“, sagte neulich eine Klientin. Ganz klar hat sie mit ihrem Wunsch nach Veränderung auch ihre eigene Vergänglichkeit bedacht. Was für ein Katalysator! Was mir wichtig ist und nicht von selbst kommt, das muss ich geschehen lassen.
Durch meine Begegnungen mit Älteren habe ich Gelegenheit, selbst viel bewusster ins Alter zu gehen. Ich lerne so viel von ihnen. Manche sind weise und ich bewundere sie. Nicht weil sie so meisterhaft jung blieben, das wäre doch schade, wenn man die Chance hat, alt zu werden. Sondern weil sie die Kraft und die Klugheit, die Gelassenheit, den Humor und die Liebe haben, ihr Leben erfüllt zu leben – weiter und weiter. Ich hoffe und wünsche, dass mir das auch gelingt. Ich habe ja nicht ewig Zeit.
Dieser Beitrag ist ein Auszug aus Julia Wahrens Projektarbeit zur VFP-Zertifizierung.

Julia Wahren
Heilpraktikerin für Psychotherapie, systemisch-integrale Beraterin mit Praxis in München
1) SCHLUSS.TON. Film von Julia Wahren: https:// wahren-performance.de/schluss-ton