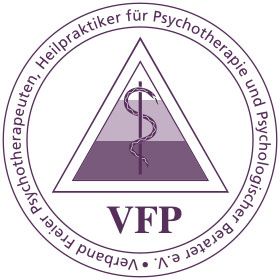Biografie Ü50
VOM SICHVERLIEREN UND SICHWIEDERFINDEN
Viele Menschen möchten bewusst ein sinnhaftes Leben führen. Nicht im Sinne von Selbstverwirklichung oder gar „Optimierung“, sondern derart, den verschiedensten Facetten ihrer Persönlichkeit auf die Spur zu kommen. „Demnach gibt es ein Ich, das sich immer erst herausstellen will. Und dieses immer erst zukünftige Ich scheint mir die Gestaltungskraft zu sein, die eine Biografie schreibt.“ (Wais 2014, S. 39)
Bestimmte Lebensphasen – und verstärkt bei Lebensübergängen, in denen etwas Altes verlassen und sich auf etwas Neues zubewegt wird, sind oftmals Anreiz zur verstärkten Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Auf welchen Pfaden sind wir bislang beruflich und privat gewandert, welche neuen Wege wollen wir (noch) einschlagen und welcher rote Faden webt sich durch den eigenen Lebensteppich? Diesen können wir zukunftsorientiert aufgreifen: mitten im Leben und gegen Lebensende für die Menschen, denen wir in Erinnerung bleiben oder die wir begleiten wollen. Gelebte und reflektierte Biografie: Denn ganz im Sinne Hannah Arendts gibt es keinen Denkvorgang, der ohne persönliche Erfahrung möglich ist.
KEINE HÜTER DER VERGANGENHEIT
Mein Verständnis von Biografiearbeit ist keine Rekonstruktion eines chronologischen Lebenslaufes oder kein vorwiegend auf schwierige Lebensphasen gerichteter Fokus. Und wenn Letzteres, die Herausforderungen der bisherigen Biografie mit dem persönlichen Gewinn anzugehen, in Kontakt mit Liegengebliebenem, Versäumten, vielleicht (scheinbar) Verlorenem, und damit letztendlich zu uns selbst zu kommen. Diese Erfahrungen wie die Freudenbiografie als Früchte unseres Lebens zu betrachten und auch zu würdigen, nehmen in der „gefühlten“ Lebensmitte ab um die 40 bis Anfang 60, und verstärkt in der Vorbereitung auf das Lebensende eine größere Bedeutung ein.
Diese vertiefte Kontaktaufnahme mit uns selbst eröffnet auch in schwierigen Lebensphasen die Chance, mehr Tage zu erinnerungswerten Tagen zu machen, wenn wir sinngebende, glückliche Erfahrungen aus unserem vergangenen Leben ausgraben, um glückliche Erinnerungen in der Gegenwart zu erzeugen. Denn unsere bisherige Biografie besteht nicht aus einer Aneinanderreihung von Tagen, sondern aus denen, an die wir uns erinnern. Mit Biografiearbeit mögen wir darüber hinaus unser Leitmotiv im Leben finden und den roten Faden darin nachvollziehen und weiterweben. Ein Gestern, dem wir unabhängig von einzelnen Ereignissen als Ganzes Sinn verleihen können, ist die beste Voraussetzung für ein bewusstes oder gar glückliches Heute.
Unsere Erinnerungen gehören uns, man kann sie uns nicht weg- nehmen.
Unser Gedächtnis ist kreativ und unsere Erinnerungen sind es auch. Sie sind oftmals alles andere als akkurat; vielmehr sind sie formbar und unser Geist setzt sie jeweils so zusammen, wie es uns gerade passend erscheint. Wir üben uns in der Unterscheidung zwischen inneren und äußeren Bildern und können auch eine Distanz zu ihnen einnehmen. So werden wir ein Stück weit unabhängig und finden eine authentische Antwort auf die Frage: Was will ich für mich als ein gelungenes Leben ansehen und wie will ich es eines Tages abschließen? Viele Menschen fragen sich in kritischen Lebensphasen nach dem Woher und Wohin. Hier bietet Biografiearbeit eine Chance der Bilanzierung, ob der derzeitige Status tatsächlich zu einem passt? Ob ein anderer Weg als der bisherige zu einem anderen Ergebnis geführt hätte? Was haben wir getan und was unterlassen? Diese Rückschau führt zu den eigenen Wurzeln mit dem Ziel, das derzeitige und künftige Leben in Übereinstimmung mit den persönlichen Einstellungen, Werten und Bedürfnissen zu bringen. Wir können aktiv dazu beitragen, unserem Leben Sinn zu geben, wo es an Sinn mangelt oder wo Ungewissheit herrscht, mit der wir bewusst umgehen wollen.
PIONIERE IN EIGENER SACHE
Gelingen und Scheitern umfasst den ganzen Reichtum unseres Lebens. Manche Erfahrungen sind womöglich eingekapselt und können durch achtsame therapeutische Begleitung ins Erinnern und Fließen kommen. Viele Erinnerungen entstammen dem sogenannten ersten Mal und sind damit Schlüsselerfahrungen, wie der Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule, der Schul- oder Ausbildungsabschluss, der erste Liebeskummer, die Geburt des Kindes, das Erreichen wichtiger beruflicher Ziele, Traumatisierungen. Doch nicht nur das erste Mal ist bedeutsam, sondern auch das letzte Mal, z. B. der Tod eines wichtigen Menschen, mit dem wir zuvor ein letztes Mal gesprochen haben, oder der Austritt aus dem Berufsleben. Immer da, wo etwas Herausragendes in unserem Leben geschehen ist, werden die Erinnerungen daran präziser oder sie werden aufgrund großen Schmerzes verdrängt und bleiben dann im Inneren verkapselt.
Unsere Erinnerungen gehören uns, man kann sie uns nicht nehmen. Wir sind aber keine Hüter der Vergangenheit, sonst würden wir uns von uns selbst entfremden und neue Entwicklungen, die sich ankündigen, nicht in unser Leben integrieren. Vor allem in der Verbindung zwischen Altem und Neuem ergibt sich eine Perspektive für unsere Zukunft. „Erfahrungen, die wir an Lebensübergängen gemacht haben: Das sind die Erinnerungen, die aus der Fülle des gelebten Lebens herausragen und die für uns die Pfeiler unserer Identität darstellen. Diese Erfahrungen sind es, die vor allem bewirken, dass wir sind, wer wir sind. Das gilt auch von den Übergängen, mit denen wir nicht gerechnet haben, in die wir hineingeworfen werden.“ (Kast 2014, S. 17)
„Die besten Jahre“ nennt die Moderatorin der „Sternstunden Philosophie“ und Autorin Barbara Bleisch die Mitte des Lebens (siehe Literaturhinweise). Als eine Phase der Fülle, die laut ihr zu unseren freiesten Jahren werden können, wenn wir deren existenziellen Fragen nicht aus dem Weg gehen. Fragen, ob es das nun gewesen ist oder ob das Leben noch etwas Großes mit uns vorhat? Eigentlich haben wir alles erreicht, und nun? Was erfreut uns in unserem Lebensrückblick und was bedauern oder bereuen wir auch? Können wir in den nächsten Jahren noch eine neue Spur einschlagen? Wie schauen wir dem Lebensende entgegen und bereiten uns darauf vor? Kann der Tod ein Lebenshelfer sein? „Die Dringlichkeit, die der Bewusstwerdung des eigenen Todes entspringt, ist eines der Grundthemen der existenzialistischen Philosophie des frühen zwanzigsten Jahrhunderts. Sie spricht dem Gedanken an das eigene Sterben große Bedeutung für eine gelingende Existenz zu. Ihr zufolge gilt es, das Leben vom Tod her zu denken und so erst buchstäblich „führen“ zu können. (Bleisch 2024, S. 64)
DAS HERZ HAT KEINE FALTEN
Biografiearbeit lässt den roten Faden der eigenen Geschichte erkennen und weiterweben. Sie unterstützt auch die Haltung, mit der wir durchs Leben gehen und altern wollen. Verleugnen wir die (ersten) Spuren? Ordnen wir uns gesellschaftlichen Vorurteilen von alten Frauen und Männern unter und bleiben bei dem, was sich bislang scheinbar bewährt hat?

Fragen, ob es das nun gewesen ist, oder ob das Leben noch etwas Großes mit uns vorhat?
Oder wollen wir mit jedem weiteren Lebensjahr eine eigene Beziehung zu uns selbst, zu unserer Arbeit, zu unseren Interessen und Bedürfnissen und zu anderen Menschen pflegen? Der deutsche Altersforscher Hans-Werner Wahl spricht von einer Erfolgsgeschichte heutigen Alterns. Wir dürften das Alter neu denken, weil es uns heute in vielerlei Hinsicht neu begegne. „Mobil sein, interessiert sein, kompetent sein, neugierig sein, funktionstüchtig sein, selbstbewusst sein, engagiert sein, auch materiell relativ gut ausgestattet sein – das sind einige der Kerneigenschaften, die das heutige Alter über weite Strecken kennzeichnen. (Wahl 2017, S. 13) Wohlbefinden scheint also auch im Alter nicht kleinzukriegen zu sein. Offenbar nutzen ältere Menschen eine Vielzahl von Strategien, die durch Biografiearbeit in Form von Ressourcen bewusst gemacht und bei Bedarf erweitert werden können. Ältere konzentrieren sich auf besonders wichtige Dinge und Menschen und lassen andere Erfahrungen, die sie auch noch machen könnten, links liegen. Sie möchten intensiv Positives erleben und tragen dazu bei, damit ungute Entwicklungen möglichst nicht (mehr) stattfinden. Im übertragenen Sinn lädt auch die Autorin Elke Heidenreich in ihrem Buch „Altern“ zur Biografiearbeit ein (siehe Literaturhinweise). Gleich am Anfang beschreibt sie zwei völlig gegensätzliche Perspektiven, mit denen sie rückblickend auf ihr Leben schauen könnte. „Ich habe mein Leben komplett in den Sand gesetzt.“ Und: „Ich hatte ein unfassbar wunderbares Leben.“ „So. Und nun suchen Sie sich aus diesen zwei Lebensversionen doch bitte eine aus.“ (Heidenreich 2024, S. 9-11) Damit beschreibt die Autorin eindrücklich die große Lebenskunst des Perspektivenwechsels, der auch in der Biografiearbeit eine tragende Rolle spielt.
LEBENSRÜCKBLICKTHERAPIE UND WÜRDEZENTRIERTE THERAPIE
Auch wenn die von Gerontologen und Pflegewissenschaftlern entwickelte Lebensrückblicktherapie v. a. für ältere Menschen eine bereichernde Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie ist, kann sie auch jüngeren einen vertieften Kontakt mit den eigenen Ressourcen ermöglichen. Es handelt sich dabei um eine psychotherapeutische Kurzzeitintervention mit dem Ziel einer verbesserten Lebensqualität im Alter und zum Lebensende hin. Ziel ist keine Bearbeitung der ganzen Vergangenheit, sondern sich einzelnen, bis heute belastenden Erfahrungen darin zuzuwenden, um sie aufzuarbeiten. „Ich bin auf diese Form der Therapie gekommen, weil immer mehr Menschen in höherem und hohem Alter, die einen Lebenspartner oder eine Lebenspartnerin verloren haben, um Hilfe gebeten hatten. Es handelte sich gelegentlich um komplizierte Trauer, oft aber auch um ein Problem innerhalb der natürlichen Trauer, ein Problem, das diesen Menschen das Gefühl gab, im Trauerprozess stecken zu bleiben. Diesen Hilfesuchenden war gemeinsam, dass sie keine langen Psychotherapien machen wollten: Sie wollten sich mit dem ihnen wichtigen Thema mit einem anderen Menschen auseinandersetzen. Gemeinsam war ihnen auch, dass sie der Ansicht waren, ihr Leben bislang gut gemeistert zu haben und es auch weiter meistern zu können: Sie störte nur dieses eine Problem. (Kast 2014, S.157) Die nach C.G. Jung ausgebildete und tätige Psychoanalytikerin Verena Kast betont in dieser Art der Therapie bestimmte Aspekte, die sich aus ihrer Arbeit mit älteren Menschen ergeben haben. So geht es ihr keinesfalls um das Sammeln von Informationen zum Leben einer Person, sondern darum, dass diese sich die Erinnerungen lebendig vergegenwärtigen und
Biografiearbeit lässt den roten Faden der eigenen Geschichte erkennen.
dazu imaginieren. „Dann werden die Emotionen berührt, kann sich Veränderung auch ereignen.“ (Kast 2014, S. 161) Mit einer Freudenbiografie kann man einen freundlicheren Blick auf das vergangene Leben werfen. Gibt es Themen, die als schuldhaft bewertet werden, schaut man sie im Jetzt an und nicht aus früherem schuldhaften Handeln heraus. „Es ist hilfreich, sich Geschichten von Erlebnissen und Erfahrungen zu vergegenwärtigen; möglichst auch Geschichten vom Gelingen, die in die Zeit der zu bearbeitenden Problematik fallen. (Kast 2014, S. 161) Besonders konfliktbehaftete Themen können hinsichtlich der darin gebundenen Lebensthemen zugänglich gemacht und verwandelt werden. „Persönliche Erfahrungen können in Resonanz zu kulturellen Gestaltungen neue Impulse geben.“ (Kast 2014, S. 161)
In ihrem Buch „Wie lange ist nie mehr“ setzt sich die Schriftstellerin Doris Büschel als namenlose Ich-Erzählerin mit der Endlichkeit auseinander (siehe Literaturhinweise). Sie stellt sich schreibend ihren Lebensthemen und beginnt, zusammen mit dem Hospiz an ihrem Heimatort, mit Menschen in deren letzter Lebensphase Briefe zu verfassen. Der Frage nach dem, was bleibt – den Erinnerungen am Ende des Lebens – stellt sich auch der Professor für Psychiatrie Harvey Max Chochinov in Kanada, der mit seinem Konzept der „Würdezentrierte Therapie“ eine weltweit beachtete manualisierte Kurzintervention für Patient:innen mit lebensverkürzenden und lebensbedrohenden Erkrankungen entwickelt hat (siehe Literaturhinweise).
Anmerkung der Autorin: Fortbildungen in dieser Therapieform siehe Website der Deutschen Gesellschaft für Patientenwürde e. V. Mainz. In Planung für 2027 mit dem Hospizverein Konstanz für die Bodensee-Region (Auskunft hierzu bei Anja Mannhard).
Literatur
Bleisch, B. (2024) Mitte des Lebens. Eine Philosophie der besten Jahre. München: Hanser
Chochinov, H. M. (2017) Würdezentrierte Therapie. Was bleibt – Erinnerungen am Ende des Lebens. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
Heidenreich, E. (2024) Altern. Berlin: Hanser
Büschel, D. (2025) Wie lange ist nie mehr. Leben im Angesicht der Endlichkeit. Lachen: Wörterseh
Kast, V. (2014) Was wirklich zählt, ist das gelebte Leben. Die Kraft des Lebensrückblicks. Freiburg: Herder
Mannhard, A. (2022) Mit Selbstrespekt durchs Leben! Wie Sie durch Selbstrespekt und Selbstachtung berufliche und persönliche Chancen ergreifen: Berlin: Parodos
Mannhard, A. (2021) Biografiearbeit. Die innere Schatzsuche. München: Scorpio
Mannhard, A. (2018) Der Lebensspur folgen. Freiburg: Herder
Wais, M. (2014) Das Ich findet sich, wenn es sich loslässt. Über den roten Faden im Leben. Esslingen: Gesundheitspflege initiativ
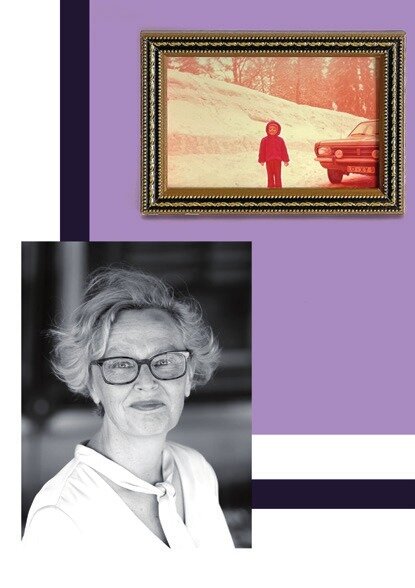
Anja Mannhard
Geprüfte Personalfachkauffrau (IHK), Lehrlogopädin und Logopädin mit Weiterbildungen in Personenzentrierter Beratung, Verhaltenstherapie, Lösungsorientierter Therapie und Systemischer Therapie, Erzieherin, Autorin, Malerin und Illustratorin