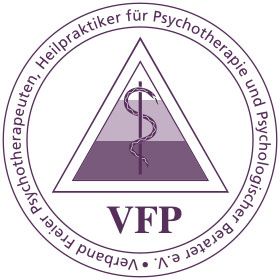Psychiatrische Therapie tritt auf der Stelle
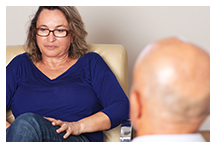 Die Ärztezeitung schreibt am 28.12.16 vom diesjährigen Kongress der DGPPN - die „Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde“ mit Sitz in Berlin ist eine wissenschaftlich medizinische Fachgesellschaft mit über 7.800 Mitgliedern, insbesondere Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie:
„Keine neuen Medikamente, keine neuen Ideen – kaum eine andere Disziplin tritt derart auf der Stelle wie die Psychiatrie. Disruptiv sind hier allenfalls die therapeutischen Auswirkungen auf das Gehirn der Patienten. Woran liegt's?“ fragt Professor Gerhard Gründer von der Uni Aachen seine Fachkollegen. Es sei eine wissenschaftliche Revolution nötig, ein Sprung auf eine neue Verständnisebene von psychischen Krankheiten, so Gründer.
Die Ärztezeitung schreibt am 28.12.16 vom diesjährigen Kongress der DGPPN - die „Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde“ mit Sitz in Berlin ist eine wissenschaftlich medizinische Fachgesellschaft mit über 7.800 Mitgliedern, insbesondere Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie:
„Keine neuen Medikamente, keine neuen Ideen – kaum eine andere Disziplin tritt derart auf der Stelle wie die Psychiatrie. Disruptiv sind hier allenfalls die therapeutischen Auswirkungen auf das Gehirn der Patienten. Woran liegt's?“ fragt Professor Gerhard Gründer von der Uni Aachen seine Fachkollegen. Es sei eine wissenschaftliche Revolution nötig, ein Sprung auf eine neue Verständnisebene von psychischen Krankheiten, so Gründer.Auch der Berliner Psychiater Professor Tom Bschor kritisiert bei dem Kongress: „So hat sich in der Pharmakotherapie in den vergangenen 60 Jahren nur wenig getan. Praktisch alle heute in der Psychiatrie verwendeten Wirkprinzipien seien im “pharmazeutischen Gründerjahrzehnt“ der 1950er-Jahre aufgespürt worden… Die Industrie, so Bschor, habe die letzten sechs Dekaden im Wesentlichen damit verbracht, Me-too-Präparate auf den Markt zu werfen. Das räche sich nun, weil das AMNOG solche Präparate nicht mehr honoriere.
Die Krise der Psychiatrie ist also bei den Patienten angekommen. Sie erhalten neue Arzneien oft nicht mehr, weil ihnen kein Zusatznutzen attestiert wird. Dabei sind Psychiater mangels aussagekräftiger Biomarker häufig auf eine Trial-and-Error-Behandlung angewiesen: Sie müssen bei Depressiven mehrere Präparate durchprobieren, bis sie ein passendes finden. Was beim einen nicht wirkt, kann dem anderen Patienten sehr wohl helfen. Eine gewisse Vielfalt ist also durchaus nötig. Wie wirken Medikamente auf die Psyche?
Das führt zu einem anderen Problem: Wie und weshalb Medikamente auf die Psyche wirken, ist noch immer nicht richtig verstanden. Die britische Psychiaterin Dr. Joanna Moncrieff sieht selbst für Antipsychotika keine spezifische Wirksamkeit. Solche Mittel, einst eingeführt als “neurologische Inhibitoren“, haben ihrer Ansicht nach eine ganze Reihe von eher globalen Effekten: Sie lähmen die körperliche Aktivität, Aufmerksamkeit, Reaktionszeit und Koordination, sedieren, führen zu emotionaler Verflachung und Gleichgültigkeit. Damit bremsen sie zwangsläufig auch eine Psychose. Vergleichen lässt sich das mit einem zu schnellen Auto: Natürlich wird es langsamer, wenn man in die Reifen schießt. Womöglich haben wir – statt nach der Bremse zu suchen – 60 Jahre lang nur effektivere Methoden entwickelt, die Luft aus den Reifen zu lassen.“
Der ganze Artikel: http://www.aerztezeitung.de/extras/druckansicht/?sid=926708&pid=936903